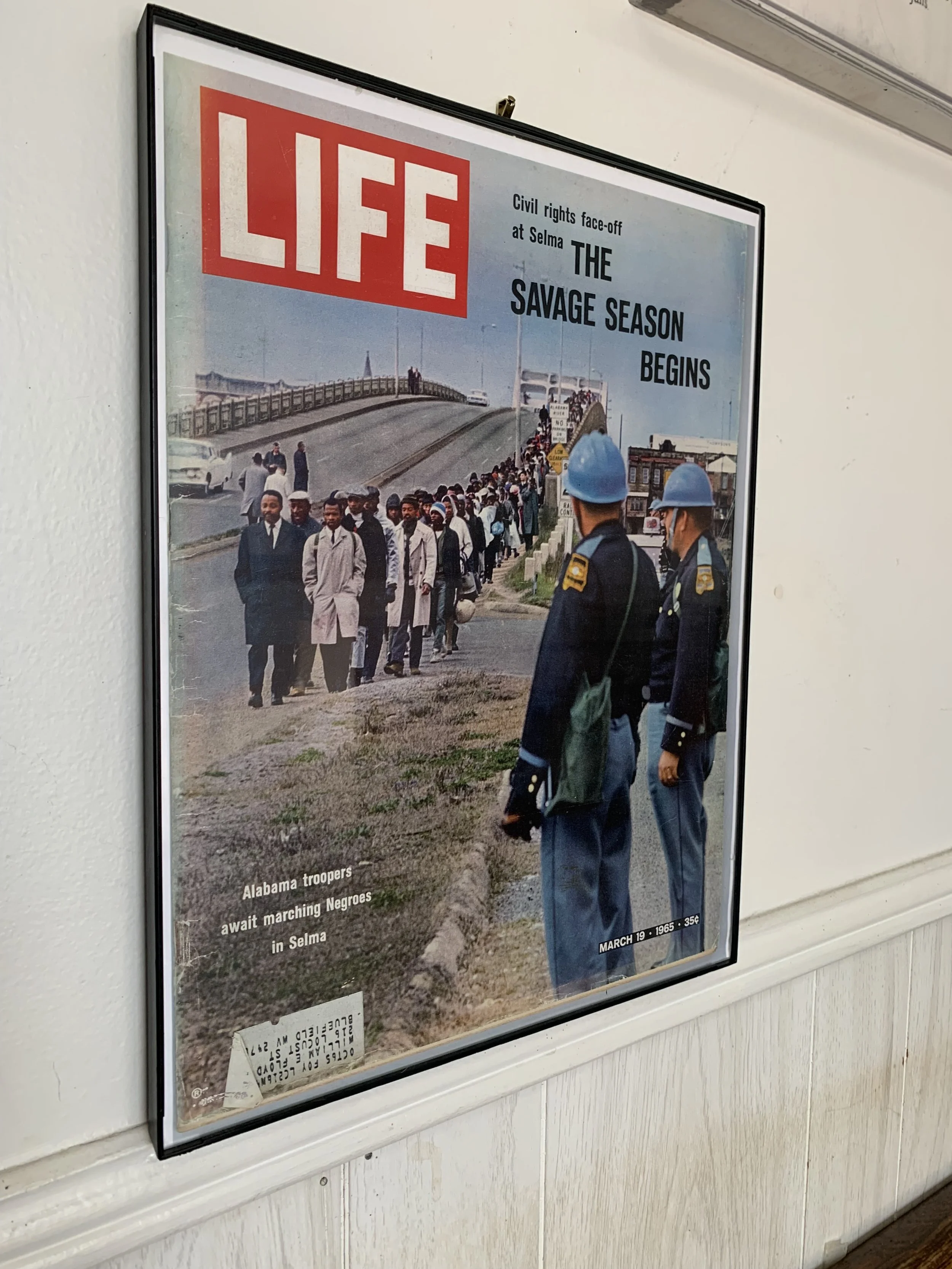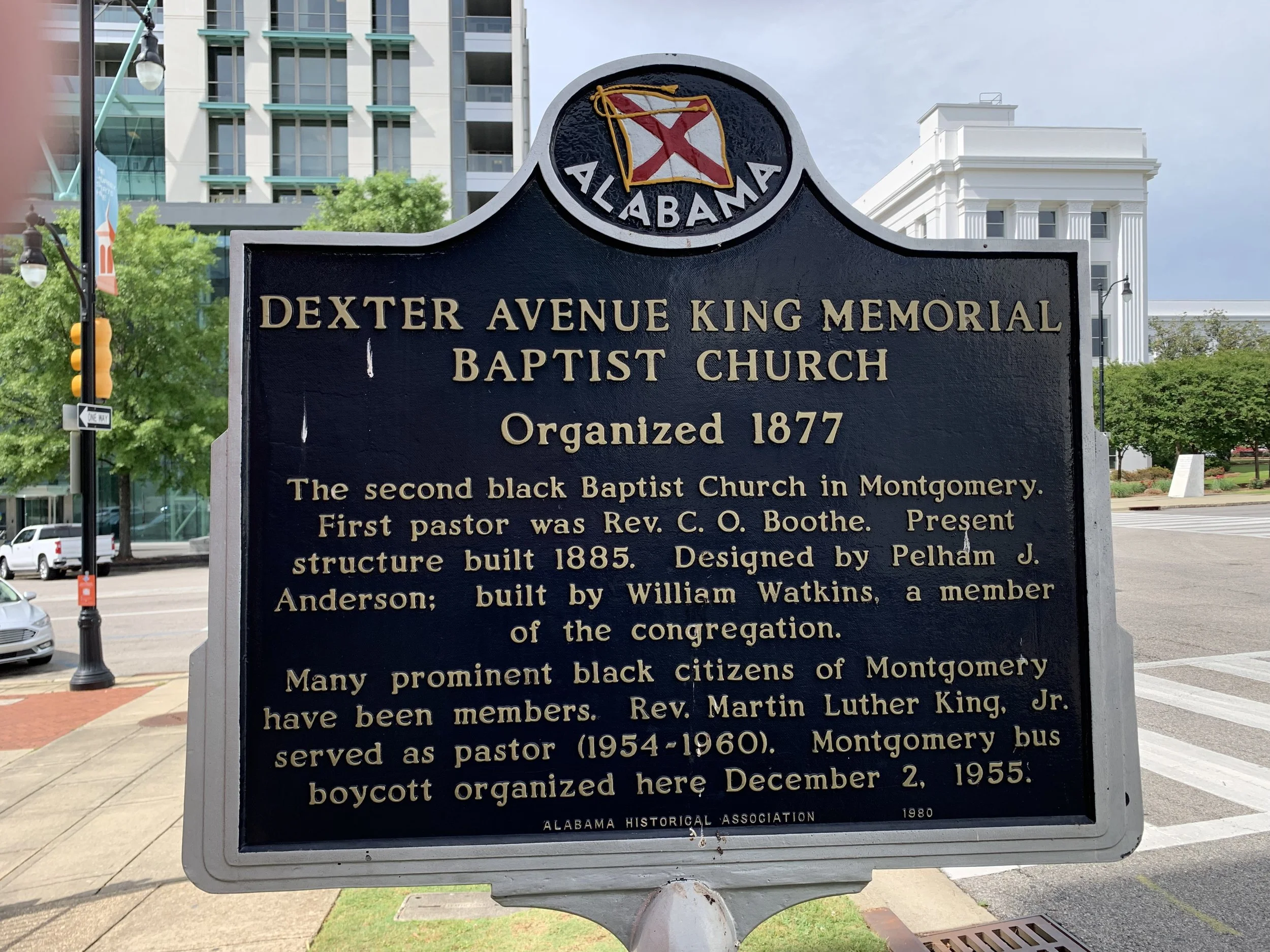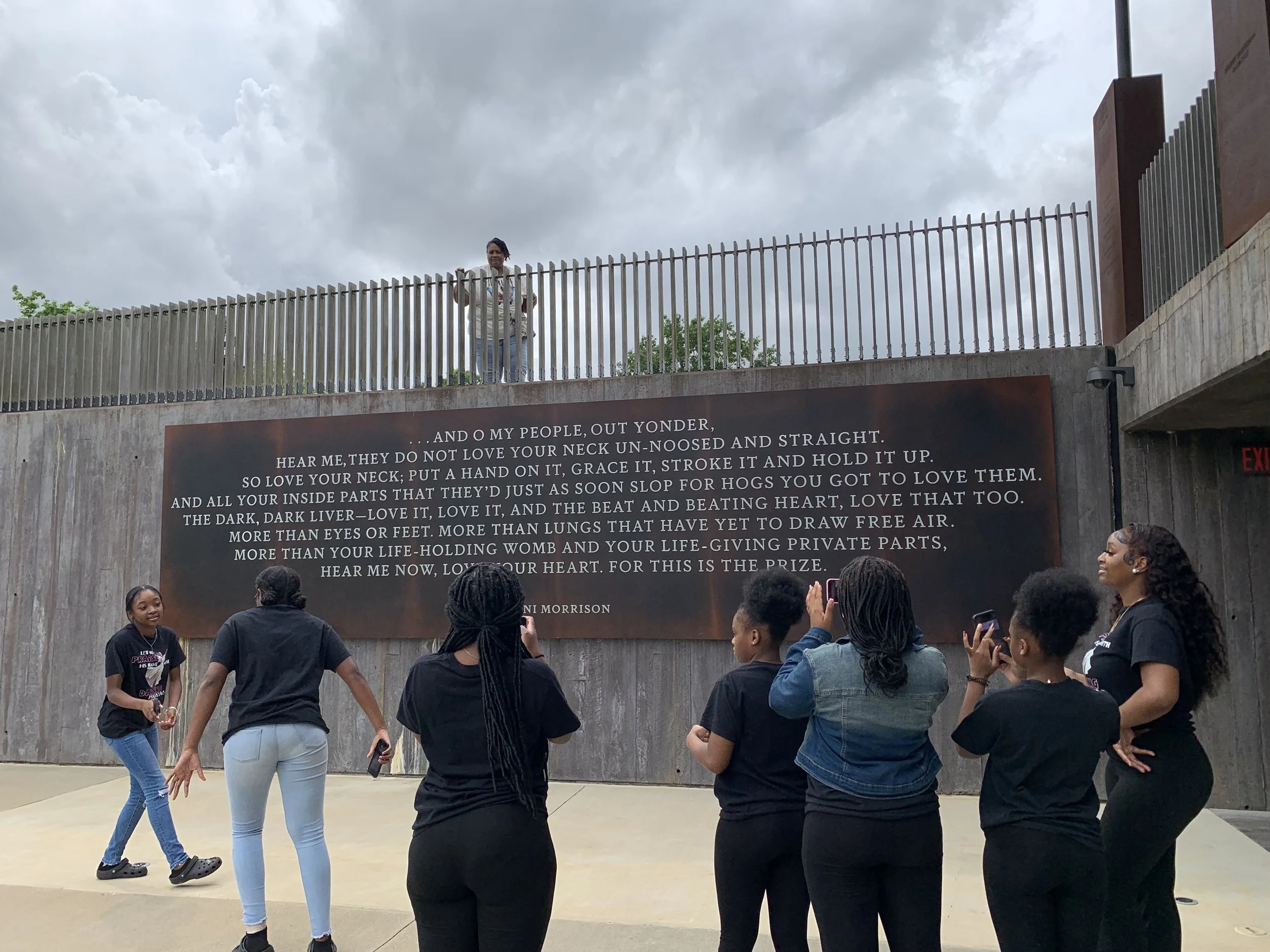Amerika & der Rest
posted by Rolf Paasch
Ugandas Präsident Museveni - und das beängstigende Szenario seiner Nachfolge
Am 15. Januar hat Uganda gewählt. Präsident Museveni wurde mit knapp 72 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt – doch niemand kennt das tatsächliche Ergebnis. Der Oppositionskandidat Bobi Wine ging aus dem Hausarrest direkt in den Untergrund, während der Sohn des Präsidenten, zugleich Oberbefehlshaber des Militärs, ihm öffentlich den Tod androht. Anders als im benachbarten Tansania drei Monate zuvor sind die Jugendlichen Ugandas in ihrer Wut über die Wahlfälschung nicht massenhaft auf die Straße gegangen, um nicht - wie dort geschehen - von den Sicherheitskräfen zu hunderten niedergeschossen zu werden. Stattdessen liegt eine unheimliche politische Stille über Dar es Salaam und Kampala, nachdem nun zwei weitere ostafrikanische Staaten den Übergang von einer Fassadendemokratie zur offenen Autokratie vollzogen haben. „Warum gehen wir überhaupt noch wählen?“, fragen sich in dieser ostafrikanischen Nachbarschaft längst nicht mehr nur Angehörige der Generation Z – während alle darauf warten, dass der Kessel voll angestauter Wut explodiert. Irgendwo. Irgendwann. Vielleicht schon bald.
Am 15. Januar hat Uganda gewählt. Präsident Museveni wurde mit knapp 72 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt – doch niemand kennt das tatsächliche Ergebnis. Der Oppositionskandidat Bobi Wine ging aus dem Hausarrest direkt in den Untergrund, während der Sohn des Präsidenten, zugleich Oberbefehlshaber des Militärs, ihm öffentlich den Tod androht. Anders als im benachbarten Tansania drei Monate zuvor sind die Jugendlichen Ugandas in ihrer Wut über die Wahlfälschung nicht massenhaft auf die Straße gegangen, um nicht - wie dort geschehen - von den Sicherheitskräfen zu hunderten niedergeschossen zu werden. Stattdessen liegt eine unheimliche politische Stille über Dar es Salaam und Kampala, nachdem nun zwei weitere ostafrikanische Staaten den Übergang von einer Fassadendemokratie zur offenen Autokratie vollzogen haben. „Warum gehen wir überhaupt noch wählen?“, fragen sich in dieser ostafrikanischen Nachbarschaft längst nicht mehr nur Angehörige der Generation Z – während alle darauf warten, dass der Kessel voll angestauter Wut explodiert. Irgendwo. Irgendwann. Vielleicht schon bald.
Mit 81 Jahren tritt Präsident Yoweri Museveni nun seine siebte Amtszeit an der Spitze Ugandas an – eines ostafrikanischen Binnenstaates mit rund 52 Millionen Einwohnern, von denen 80 Prozent jünger als 40 Jahre sind und deren Leben untrennbar mit seinen Taten und Worten verbunden ist. Die Geschichte dieses „alten Mannes“ steht exemplarisch für vieles, was bei den Führern und Befreiungsbewegungen afrikanischer Staaten schiefgelaufen ist.
Museveni wurde 1944 als Sohn einer Viehzüchterfamilie im Westen Ugandas geboren. Sein akademisches Training erhielt er im Exil an der Universität von Dar-es-Salaam, wo Ende der 1960er Jahre Afrikas kleine intellektuelle Elite nach sozialistischen Lösungen für die Probleme der gerade unabhängig gewordenen Staaten suchte. Sein politisches Denken formte sich im Uganda der 1970er- und 80er-Jahren unter den wechselnden Gewaltherrschaften von Idi Amin und Milton Obote – einer Zeit, in der Politik Krieg und Krieg war. Museveni war an der Gründung der Front for National Salvation beteiligt, die dann mit Hilfe Tansanias den „Schlächter“ Idi Amin stürzte. Doch er kehrte erneut in den Busch zurück und begann einen Guerillakrieg gegen die neue Regierung von Amins Nachfolger Milton Obote, der sich 1980 nach einer manipulierten Wahl zum Sieger erklärt hatte.
Nach fünf Jahren blutigen Bürgerkriegs übernahm Museveni 1986 als Anführer der Rebellenarmee die Macht. Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Gewalt versprach er Stabilität und nationale Einheit – und hielt dieses Versprechen zunächst auch ein. Er gelobte zudem, die Macht abzugeben, wenn die Zeit gekommen sei. Am Ende brach er all diese Versprechen. Heute fehlt es dem Land an Stabilität, während Museveni weiterhin im State House residiert.
Nach 40 Jahren an der Macht ist der ehemalige Befreiungskämpfer zur Inkarnation der old big men geworden – jenes Typs afrikanischer Autokraten, der nie rechtzeitig abtritt. Ausgerechnet vor diesem Prototypen hatte er die Ugander 1986 gewarnt, als er konstatierte: „Das Problem Afrikas im Allgemeinen und Ugandas im Besonderen sind … Führer, die an der Macht bleiben wollen.“
Die Geschichte Yoweri Musevenis und seiner aus dem National Resistance Movement (NRM) hervorgegangenen Partei steht exemplarisch für das Scheitern vieler afrikanischer Führer und Befreiungsbewegungen, demokratische Regeln einzuführen und Wahlniederlagen zu akzeptieren; für ihre Weigerung, die Popularität politischer Gegner anzuerkennen und die hierarchischen, informellen Strukturen einer Kampftruppe in die Regeln einer politischen Partei zu überführen.
Man schaue nur nach Kamerun, wo Paul Biya mit 92 Jahren gerade eine weitere siebenjährige Amtszeit antrat, und an die Elfenbeinküste, wo Präsident Alassane Ouattara mit 83 Jahren seine vierte Amtszeit gewann. Oder man blicke auf Zanu-PF in Simbabwe, SWAPO in Namibia oder Frelimo in Mosambik – allesamt ehemalige Befreiungsbewegungen, die sich in ewige Regierungsparteien verwandelt haben und ihr illiberales Erbe nicht abstreifen können.
Als Rebellenführer und Präsident war Museveni so smart wie der verstorbene Robert Mugabe in Simbabwe und so strategisch wie Paul Kagame, der aus den ugandischen Rebellenbewegungen heraus zum Präsidenten des benachbarten Ruanda aufstieg. Doch sobald diese „neue Generation von Reformern“, wie sie vom Westen in den 1980er- und 1990er-Jahren gefeiert wurde, ihre Macht durch die Opposition bedroht sahen, wechselten sie vom progressiven nation building zur autoritären Absicherung ihrer Herrschaft. Aus diesem Kreis postkolonialer Führer gab einzig Tansanias Staatsgründer Julius Nyerere freiwillig die Macht ab. Doch auch Tansanias 1992 eingeführtes Mehrparteiensystem, wurde rasch von Hardlinern der regierenden CCM-Partei demontiert – zuletzt von der heutigen Präsidentin Samia Suluhu Hassan, die nach der manipulierten Wahl im Oktober 2025 ihre Sicherheitskräfte hunderte wenn nicht tausende Demonstranten töten ließ.
Im Fall Musevenis beschleunigte sich der anfänglich schleichende Autoritarismus, als er 2005 die Amtszeitbegrenzung aufheben ließ, und 2017, als er Abgeordnete bestach, um auch die Altersgrenze für das Präsidentenamt zu kippen. Die Wahlen von 2006 und 2011 waren nicht gerade frei und fair – aber jene danach nur noch eine demokratische Farce.
In seinem neuen Buch Slow Poison: Idi Amin, Yoweri Museveni, and the Making of the Ugandan State vergleicht der renommierte ugandische Intellektuelle Mahmood Mamdani Musevenis Fortsetzung der britisch-kolonialen Politik des „teile und herrsche“ mit Idi Amins brutalem Versuch, durch die Vertreibung der indischen Minderheit 1972 eine schwarze ugandische Nation zu schaffen. Wo Amin die Nation rassifizierte, tribalisiert Museveni sie. Die „kontinuierliche Fragmentierung der unterworfenen Bevölkerung, ein endloser Prozess, verstärkt durch staatliche Gewalt und institutionalisierte Korruption – unterschiedliche Methoden, um Widerständige zu disziplinieren und Kollaborateure zu belohnen – das nenne ich ‚langsames Gift‘“, schreibt Mamdani. Der Vater des neuen Bürgermeisters von New York ist überzeugt, dass „die Museveni-Ära die Moral einer ganzen Generation zersetzt hat“ und es einer weiteren Generation bedürfe, um aus der „allgegenwärtigen Korruption und dem Zynismus, die das Land wie Nebel umhüllen“, herauszufinden.
Trotz dieses Zynismus führte der populärste Oppositionskandidat Bobi Wine nach 2021 erneut einen beeindruckenden Wahlkampf. Der 43-jährige Reggae & Rockstar, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi heißt, zog landesweit große Menschenmengen an – in Bildern, die kaum zu seinem offiziellen Wahlergebnis von 24 Prozent passten. In seiner markanten Kampfmontur mit Helm und kugelsicherer Weste wurden Bobi Wine immer wieder gestoppt und schikaniert, Mitglieder seines Teams verhaftet, Aktivisten seiner National Unity Platform (NUP) getötet und seine Anhänger auf den Straßen mit Tränengas attackiert.
Auch Kizza Besigye, Musevenis langjähriger Rivale, der ihn in vier voraufgegangenen Wahlen herausgefordert hatte, sitzt seit über einem Jahr wegen fingierter Anklagen im Gefängnis und erhält inzwischen nicht einmal mehr angemessene medizinische Versorgung.
Dieser ungleiche Machtkampf zwischen einem über 80-jährigen Garant vermeintlicher Stabilität und einem Musikstar, der für Wandel steht, spielte sich in einem Land ab, das 2025 zwar ein Wirtschaftswachstum von sechs Prozent vorweist, zugleich aber eine offiziell ausgewiesene Jugendarbeitslosigkeit von 43 Prozent verzeichnet. Es ist ein Land, das seit seiner Unabhängigkeit (1962) rund 60 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe erhalten hat, dessen von Gesundheitsprogrammen abhängige Bevölkerung jedoch schwer unter der jüngsten Zerschlagung von USAID durch Donald Trump leidet. Der unfair geführte Wettstreit fand im zweitjüngsten Land der Welt statt, mit einem mittleren Alter von 17 Jahren, in dem die Hälfte der Bevölkerung noch nicht wahlberechtigt ist; in einem Land, in dem laut Afrobarometer mehr als 90 Prozent der Ugander eine Einparteienherrschaft ablehnen, aber nur etwa die Hälfte der 21 Millionen Wahlberechtigten zur Urne ging.
Beobachter werfen Bobi Wines Partei NUP vor, weder ein tragfähiges Wirtschaftsprogramm noch eine eine Strategie zur Reform des Systems zu haben. Doch was kann ein Oppositionsführer mit begrenzter Expertise und ohne Technokraten in seiner Partei unter einem derart repressiven Regime realistisch anbieten oder bewirken – außer darauf zu hoffen, dass Straßenproteste der Generation Z das System zu Fall bringen?
Die bittere Ironie liegt darin, dass Bobi Wine und seine Anhängerschaft aus dem “Ghetto” stammen – dem eigentlichen Vermächtnis von Musevenis 40-jähriger Herrschaft - aus einer „class of hustlers“, wie es der Journalist Liam Taylor beschreibt: eher „Lumpenproletariat“ als industrielle Arbeiterschaft. Diese Klasse aus überlebenstüchtigen Gelegenheitsarbeitern, Fahrern von Motorrad-Taxis und anderen informell Beschäftigten, die in Boxern und Musikern wie Bobi Wine ihre Helden sehen und ein urbanes Ghettoleben zwischen Improvisation und prekärer Existenz führen, ist im Laufe der Jahre entstanden, in denen Museveni seinem Land die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und neoliberalen Reformen verschrieb. Doch wurden diese schlecht umgesetzt und durch patrimoniale Politik unterlaufen. Die versprochene Transformation blieb aus.
Ugandas blockierte Entwicklung ist der Preis für Musevenis Entscheidung, über vier Jahrzehnte hinweg auf politische Deals statt auf die Institutionalisierung von Macht zu setzen. Ethnische Konflikte begegnete er mit Tribalismus, Probleme der lokalen Verwaltung mit informellen Arrangements und der internationalen Gemeinschaft bot er die Dienste seines Militärs in Somalia, Sudan und anderswo an – im Gegenzug für die stillschweigende Akzeptanz seines autokratischen Regierungsstils. Seine Herrschaft bewegte sich stets zwischen Kooption und Zwang, zwischen dem Einkaufen von Loyalität und der Bestrafung von Widerstand.
Gegen dieses verfestigte Regime, das über erhebliche Mittel zur Bestechung und zahlreiche Instrumente zur Unterdrückung verfügt, haben politische Parteien und andere oppositionelle Stimmen kaum eine Chance. Die lautstärksten und wirkungsvollsten zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Chapter 4 wurden wenige Tage vor der Wahl suspendiert. Das Internet wurde am 13. Januar für fünf Tage abgeschaltet.
Und Ugandas Medien waren im Wahlkampf von 2026 nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die etablierten Medien berichteten kaum über Polizeigewalt und die Entführungen von Oppositionspolitikern, nachdem die Redaktionen offizielle Warnschreiben erhalten hatten. Führende Kolumnisten mäßigten ihre Kritik an der Regierung. Angesichts des persönlichen Preises, den politische Aktivisten und einige mutige Reporter während der Wahlkämpfe von 2021 und 2026 zahlen mussten, ist diese Zurückhaltung mehr als verständlich.
Auch die international Diplomatie reagierte kaum auf staatliche Gewaltexzesse, die Einschüchterung der Opposition oder die offensichtliche Manipulationen des Wahlprozesses. Die Beobachtermission der Afrikanischen Union äußerte vorsichtige Kritik am Wahlprozess, doch zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs gratulierten Museveni rasch zu seinem überzeugenden Sieg. Statt einen der Ihren zu kritisieren, unterstützen sich ostafrikanische Machthaber mittlerweile gegenseitig – durch Entsendung von Sicherheitskräften zur Repression im Nachbarland oder durch die zwangsweise Rückführung geflohener Politiker und Aktivisten.
Die westliche Diplomatie scheint weiterhin dem Glauben verhaftet, die Stabilität eines autoritären Regimes sei einer ungetesteten Opposition mit Rückhalt auf der Straße vorzuziehen. Dann doch lieber Museveni – the devil you know – mit dem man danach wieder zur entwicklungspolitischen Routine zurückkehren kann. Kaum jemand stellt dabei die Frage, ob das bloße Abhalten von Wahlen weiterhin Voraussetzung oder Bewertungskriterium für Entwicklungshilfe sein sollte.
Mit der Wiederwahl Musevenis ist jetzt endgültig der Kampf um seine Nachfolge eröffnet. Beobachter wie Kristof Titeca haben wiederholt auf die extreme Personalisierung der Macht, die zunehmende Militarisierung und ethnische Patronage unter Museveni hingewiesen. „Ugandas Übergang“, so Titeca, „wird wahrscheinlich von seiner Familie, dem Militär, ethnischen Dynamiken und regionalen Mächten bestimmt werden – bei einem erheblichen Risiko von Instabilität.“
Innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl hat sich diese Einschätzung bestätigt. General Muhoozi Kainerugaba, Musevenis Sohn und Oberbefehlshaber der Armee – seit langem berüchtigt für seine entgleisten Äußerungen in sozialen Medien – hat jetzt offen die politische Bühne betreten. Nachdem er zunächst geschworen hatte, Bobi Wine zu töten, löschte er seine gewalttätigen Tweets – nur um wenige Tage später zu verkünden, seine Truppen hätten 2.000 angebliche NUP-„Terroristen“ festgenommen, 30 getötet, und der flüchtige Bobi Wine werde „lebend oder tot“ gefasst.
Währenddessen terrorisierten die Schläger des von ihm aufgebauten Special Forces Command (SFC), Bobi Wines Ehefrau und Kinder in ihrem Haus. Erst daraufhin äußerten der diplomatische Dienst der Europäischen Union, UN-Generalsekretär António Guterres und Mitglieder des US-Senats Kritik an der Gewalt vor und nach der Wahl und erwägen Sanktionen gegen den unberechenbaren General. Aus seinen Verstecken heraus wandte sich Bobi Wine per Facebook an die internationale Gemeinschaft und forderte Sicherheitsgarantien.
Gerüchte über ein sogenanntes „Muhoozi-Projekt“ – die Inthronisierung des Präsidentensohns als Nachfolger Musevenis – kursieren in Kampala seit mehr als einem Jahrzehnt. Muhoozis rascher Aufstieg von der Ausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst bis zum Chef des SFC, später der Armee und schließlich 2024 der gesamten Streitkräfte, spricht für dieses Szenario.
Trotz seines fragwürdigen Charakters hat der polternde Sohn seine politische Karriere systematisch vorangetrieben. Mit der Patriotic League of Uganda gründete er ein Gebilde zwischen Fanclub und Partei. Als Gründer der “MK-Bewegung” gab der 51-Jährige vor, für Generation Z zu sprechen. Mit rassistischen Tiraden gegen die Volksgruppe der Buganda in der Zentralregion um Kampala – einer Hochburg Bobi Wines und seiner NUP – instrumentalisiert Muhoozi ethnische Bruchlinien unter der oberflächlichen Stabilität von Musevenis Uganda.
Vor allem aber hat er schrittweise die sogenannten „historicals“ marginalisiert – jene angesehenen Soldaten, die mit seinem Vater im Buschkrieg gekämpft hatten und später zu Generälen mit professionellem Ethos wurden. Viele Ugander, auch Anhänger der Opposition, hatten lange gehofft, dass einer oder mehrere dieser Generäle die Macht übernehmen könnten, wenn das Museveni-Regime zerfällt.
Dass General Muhoozi nach der gefälschten Wahl über die sozialen Medien oder die Befehlskette der Armee ohne erkennbare Zurechtweisung aus dem Präsidentenpalast offen zur Gewalt aufrufen kann, deutet jedoch darauf hin, dass Museveni die Kontrolle über seinen durchgeknallten Sohn - und über die zukünftige Regierungsführung des Landes - verloren hat.
Vorerst genießt der Präsident seine siebte Amtszeit in dem nach seiner Einschätzung friedlichen und stabilen Land. Doch mit jedem Tag seines Schweigens wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das Uganda Musevenis einen Nachfolger bekommt, der den erratischen Narzissmus Donald Trumps mit der mörderischen Skrupellosigkeit Idi Amins verbindet. Dieses mögliche Szenario zeigt auch, womit sich Generation Z in einem militarisierten afrikanischen Land auseinandersetzen muss, das sich fest im Griff der herrschenden Familie befindet.
Wie Trumps Rohstoff-Imperialismus Amerikas Zukunft schadet
In dem Moment, in dem Donald Trumps Narzissmus neue geopolitische Höhen erreicht, ist es an der Zeit, über den angerichteten Schaden nachzudenken – nicht nur für die ohnehin angeschlagene internationale Ordnung, sondern für die Vereinigten Staaten selbst. Es gilt, den Präsidenten nicht als Garanten, sondern als Saboteur der Zukunft Amerikas zu betrachten und den Blick auf jene Figuren und Einflussmakler zu richten, die unter seiner erratischen, widersprüchlichen und bisweilen brutal ehrlichen Führung gedeihen. Trumps jüngster Anfall eines rückwärtsgewandten Energie-Imperialismus dürfte dem Rest des Westens vor Augen führen, worauf die großspurigen Versprechen und reaktionären Politiken der radikalen Rechten letztlich hinauslaufen: auf eine Schwächung der eigenen Nation im „Great Game“ des globalen Wettbewerbs.
In dem Moment, in dem Donald Trumps Narzissmus neue geopolitische Höhen erreicht, ist es an der Zeit, über den angerichteten Schaden nachzudenken – nicht nur für die ohnehin angeschlagene internationale Ordnung, sondern für die Vereinigten Staaten selbst. Es gilt, den Präsidenten nicht als Garanten, sondern als Saboteur der Zukunft Amerikas zu betrachten und den Blick auf jene Figuren und Einflussmakler zu richten, die unter seiner erratischen, widersprüchlichen und bisweilen brutal ehrlichen Führung gedeihen. Trumps jüngster Anfall eines rückwärtsgewandten Energie-Imperialismus dürfte dem Rest des Westens vor Augen führen, worauf die großspurigen Versprechen und reaktionären Politiken der radikalen Rechten letztlich hinauslaufen: auf eine Schwächung der eigenen Nation im „Great Game“ des globalen Wettbewerbs.
Selbst gemessen an Donald Trumps destruktiven Maßstäben war der Jahresbeginn stürmisch. Er ließ dennie gewählten Diktator Venezuelas entführen und übernahm die Kontrolle über die Ölvorkommen des Landes – ein klarer Bruch des Völkerrechts. Er drohte Kuba, Kolumbien und sogar Grönland mit militärischer Invasion, ungeachtet der NATO-Mitgliedschaft Dänemarks. Und seine Regierung zog sich aus 66 UN- und internationalen Organisationen zurück, viele davon mit dem Ziel einer nachhaltigen Energiepolitik.
Und er verteidigte die Ermordung einer unschuldigen Demonstrantin in Minneapolis durch einen Agenten der Einwanderungspolizei ICE auf Migranten-Jagd. Pech für die dreifache Mutter, die ihren armierten Todesschützen durch das offene Autofenster mit den Worten angesprochen hatte: „Ich bin nicht wütend auf Sie.“ Daraufhin beschimpfte er sie als „fucking bitch“ und erschoss sie ohne selbst bedroht zu sein. So viel zur Eskalation der Gewalt zu Beginn des Jahres 2026 – angestiftet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Dieser emphatische Jahresauftakt versetzte die Welt in Schockstarre und ließ Donald Trump in Triumphlaune zurück, nur begrenzt durch „seine eigene Moral“, wie er vier Reportern der New York Times stolz erklärte – deren unterwürfige Fragestellungen ebenso erschütternd waren wie die Hybris des Präsidenten. „Ich brauche kein internationales Recht“, dozierte Trump. „Ja, es gibt da eine Sache: meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann.“
Warum Trump mit all dem durchkommt, ist oft beschrieben worden: Eine führungslose, schockierte Demokratische Partei und gefügige Republikaner lassen den US-Kongress als Korrektiv in der Gewaltenteilung ausfallen. Die erzkonservative Mehrheit am Supreme Court neigt dazu, einstweilige Verfügungen und gegenteilige Urteile mutiger Richter niedrigerer Instanzen aufzuheben. Hinzu kommen die zahlreichen Schwachstellen einer unzeitgemäßen amerikanischen Verfassungsordnung, die keine Partei bislang ernsthaft angegangen ist – und die es den US-Präsidenten immer wieder erlaubten, ihre Macht von Amtszeit zu Amtszeit auszubauen, bis Donald Trump kam und einer staunenden Öffentlichkeit zeigte, was sich ein Präsident durch das Beugen oder die Missachtung des Rechts heutzutage alles leisten kann.
Hinzu kommt schließlich die völlige Hilflosigkeit der traditionellen Medien, eindrücklich belegt durch das erwähnte Interview der renommiertesten Zeitung des Landes mit Donald Trump. Traurig anzusehen, dieser Mangel an Kampfgeist in der einst hoch angesehenen liberalen Presse. Dabei müsste längst allen klar sein: Wo Argumente nicht mehr zählen, erfordert der Umgang mit Trump einen Akt des Widerstands, um im heutigen Medienumfeld überhaupt wahrgenommen zu werden.
Realistischer sollte auch der Umgang mit Trumps Verstößen gegen das Völkerrecht werden. Auf dessen Regeln zu pochen, ist ehrenwert – das Ende der internationalen Ordnung zu beklagen, als könne diese morgen zurückkehren, reicht jedoch nicht aus. Denn ein Teil der Gegenreaktion auf die regelbasierte Ordnung ist durch die Heuchelei westlicher Staaten verursacht worden, die diese Regeln nur dann anwandten, wenn es ihnen passte. Heute sind wir deswegen– ob wir wollen oder nicht – wieder bei Einflusssphären angekommen.
Man kann darüber streiten, ob die vorsichtige Einordnung der Entführung Nicolás Maduros durch den deutschen Bundeskanzler als rechtlich „komplex“ taktisch klug oder feige war. Doch handelt es sich hier weniger um einen radikalen Bruch der internationalen Ordnung, als manche Kommentatoren glauben machen wollen, sondern eher um eine Rückkehr zu klassischer amerikanischer Geopolitik in der Region.
Und wenn wir bereits in einer Welt der Einflusssphären leben, erscheint es aus dieser Logik folgerichtig, keine außerhemisphärischen Wettbewerber im eigenen Hinterhof zu dulden – sei es in Venezuela oder in Grönland. Statt „die engsten Verbündeten als ‚Bastarde‘ anzuschreien“, so der Cambridge-Historiker Brendan Simms im New Statesman, „wären London und Brüssel besser beraten, eine europäische Monroe-Doktrin auszurufen, die die demokratischen Teile unseres Kontinents für externe Mächte wie die Russische Föderation oder die Volksrepublik China für tabu erklärt“. Die USA darüber zu belehren, wie sie mit ihrem Hinterhof umgehen sollen, löst Europas Probleme jedenfalls nicht.
In ihrer jährlichen Prognose globaler politischer Risiken für 2026 benennt die Eurasia Group die „politische Revolution in den USA“ als Risiko Nummer eins – dort wo „die Vereinigten Staaten selbst ihre eigene globale Ordnung demontieren“. Nicht der Wettbewerb mit China oder die Spannungen mit Russland stellten demnach die größte Gefahr dar, sondern Amerika selbst – „in einer Zeit großer geopolitischer Unsicherheit“.
Doch welches Risiko stellt Donald Trump für die USA selbst dar? Der Bericht der Eurasia Group argumentiert, dass „The Rule of Don“, einst taktischer Normbruch, sich zu einer „systemischen Transformation“ entwickelt habe – qualitativ anders als alles, was selbst die ehrgeizigsten früheren Präsidenten versucht hätten. Doch wie sieht „Donalds Herrschaft ” zu Beginn des Jahres 2026 in Bezug auf die US-Außenpolitik aus?
An der Spitze steht der 45. Präsident als einzigartige Mischung aus Entertainer, Immobilienmogul, Sonnenkönig, Mafiaboss und vormodernem Patriarchen. Trump ist narzisstisch, unideologisch, leicht zu verärgern oder zu umgarnen. Seine mentale Landkarte besteht aus Grundstücken, die man kaufen, und Ressourcen, die man ausbeuten kann. An seinem wertefreien Hof hat er ein Team aus Idioten, Ideologen und Rächern versammelt, die ihre Tech-Utopien, ihre Angst vor Migranten und ihren persönlichen Groll ausleben dürfen.
Zu seinen derzeit prominentesten Untergebenen zählen der ranghohe Berater Stephen Miller und Außenminister Marco Rubio. Miller zufolge „leben wir in einer Welt, in der wirklichen Welt, …die von Stärke, von Gewalt, von Macht regiert wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt.“ Angesichts dieser “Macht-ist-Recht”-Haltung und seiner abfälligen Äußerungen über Migranten kann man Miller mit Fug und Recht als Rassisten und Faschisten bezeichnen.
Und dann ist da „Little Marco“, wie Trump seinen ehemaligen Rivalen bei den republikanischen Vorwahlen 2016 nannte – heute sein Handlanger für die weltweite Werbung für „America First“ und die Säuberung der westlichen Hemisphäre von fremdem Einfluss. Sohn kubanischer Eltern, die Kuba zwei Jahre vor der Machtergreifung von Fidel Castro im Januar 1959 verließen, ist Rubio bereit, auf dem Weg zu einer eigenen Präsidentschaftskandidatur 2028 jeden Befehl seines Meisters auszuführen. Schweigend erledigt er Aufgaben, die vielem widersprechen, was er früher über die Vorzüge von NATO, UNO und internationalen NGOs gesagt hat; mit großem Eifer dagegen vertritt er in Lateinamerika jene Ziele, die er politisch immers schon propagiert hat – insbesondere den Regimewechsel in Kuba.
Für den Sohn von Exilanten und ehemaligen Senator aus Florida stellt die Anwendung der umbenannten „Donroe-Doktrin“ keinen illegalen Eingriff in souveräne Staaten dar, sondern lediglich eine gerechtfertigte Korrektur der Geschichte und die Rückeroberung verlorenen Eigentums. Letzteres ist ein Versprechen, das bei Teilen der Latino-Bevölkerung in Texas und Florida gut ankommt – und Marco Rubio bei einer künftigen Präsidentschaftskampagne Stimmen bringen könnte.
Während die Motivation des Außenministers für die Rückeroberung von Amerikas Hinterhof offensichtlich und teils persönlich ist, erscheint die ökonomische Logik hinter der Übernahme der venezolanischen Ölreserven weit weniger klar. Diese mögen die größten der Welt sein, sind jedoch schwer zu erschließen, erfordern hohe Investitionen und mindestens fünf Jahre, um die modernisierte Produktion wieder in Gang zu bringen. „Trumps imperialer Venezuela-Irrweg wird Amerika nicht reicher machen“, titelte die Financial Times. Schlimmer noch: Er könnte Amerikas langfristiger wirtschaftlicher Entwicklung schaden.
Die Intervention in Venezuela wirkt wie ein rückwärtsgewandter Imperialismus, der der Logik des heutigen Ölmarkts und den Energieanforderungen künftiger Technologien widerspricht. Da das globale Ölangebot auf absehbare Zeit schneller wächst als die Nachfrage und die Gewinnschwelle für US-Schieferöl bei rund 60 Dollar pro Barrel liegt, würde zusätzliches Öl aus Venezuela dem innenpolitischen Mantra „drill, baby, drill“ der Trump-Regierung zuwiderlaufen. Zudem würde es in Venezuela den “Fluch des Öls” perpetuieren – die eigentliche Ursache der chronischen politischen Instabilität des Landes.
Wie Karthik Sankaran im Online-Magazin Responsible Statecraft zusammenfasst, erscheinen „die ökonomischen Motive hinter der militärischen Intervention in Venezuela widersprüchlich, beruhend auf einem Missverständnis von Amerikas Rolle in den globalen Energiemärkten und blind für ein zentrales politökonomisches Problem Südamerikas – die Rohstoffabhängigkeit des Kontinents“. Wie eine Ironie der Geschichte mutet an, dass die US-Einmischung in Venezuela stark an den von der CIA mitinitiierten Putsch gegen den iranischen Premierminister Mossadegh von 1953 erinnert – den Beginn einer bis heute andauernden Instabilität des Landes, die sich in den aktuellen Unruhen auf Teherans Straßen manifestiert.
Mit ihrem Ölraub setzt die Trump-Regierung auf fossile Energien, während Konkurrenten wie China massiv in erneuerbare investieren, um den enormen Energiehunger einer KI-getriebenen Wirtschaft zu stillen. Wie Bruno Maçães im New Statesman vorrechnet, werden Chinas Rechenzentren dank günstiger und schnell skalierbarer erneuerbarer Energien bis 2030 nur rund vier Prozent des gesamten Stromverbrauchs ausmachen – gegenüber zwölf Prozent in den USA. Wenn der künftige Energiebedarf von KI-Konzernen mit dem der privaten US-Haushalte konkurriert, könnten steigende Strompreise politische Verwerfungen auslösen.
Zusammengefasst: Es ist das eine, die eigene Einflusssphäre gegen politische Gegner und wirtschaftliche Konkurrenten zu sichern. Es ist etwas ganz anderes, diese Macht klug und effektiv zu nutzen – woran die Trump-Regierung in ihrem nativistischen Eifer und ihrer schieren Inkompetenz aber scheitert. Die jüngsten Auseinandersetzungen in Lateinamerika, Grönland – und bald wohl auch im Iran – mögen auf einen unvermeidlichen Machtkampf zwischen den USA und China hindeuten. Doch Trumps Unfähigkeit, diese Herausforderungen mit den Mitteln einer liberalen Demokratie und der regelbasierten Rationalität eines geopolitischen Realismus anzugehen, dürfte der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit Amerika’s erheblich schaden.
Bleibt zu hoffen, dass die ernüchternden Ergebnisse von Trumps Rohstoff-Imperialismus potenziellen Wählern rechter Parteien in Europa vor Augen führen, wohin großspurige Versprechen und die rückwärts gewandte Politik eines populistischen Projekts am Ende führen: zum Schaden der eigenen Nation in einer instabilen, multipolaren Welt.
Rache und Gewalt aus dem Weißen Haus
Fast ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Präsidentschaft verströmt Donald Trump Rachsucht und Gewaltfantasien wie ein Verrückter. Indem er dem linksliberalen Filmregisseur Rob Reiner die Schuld an dessen Ermordung zuschreibt und eine Familientragödie in Hollywood zur Selbstverherrlichung missbraucht, hat Trump’s maligner Narzissmus eine neues Niveau erreicht. Doch dieser Vorfall ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe moralischer Grenzüberschreitungen, welche die Lust der MAGA-Anhänger an Grausamkeit befeuern – während sich traditionelle Republikaner kaum davon distanzieren. Warum kommt Präsident Trump mit rechtswidrigem Verhalten und einer verrohenden Sprache durch, wie sie noch vor wenigen Jahren in einem demokratischen Umfeld undenkbar schienen? Warum führt seine offenkundige Entgleisung nicht zu offenem Widerstand, spontanen Demonstrationen, neuen Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren oder einem dramatischen Umschwung in den Umfragen? Warum wirken seine politischen Gegner so ratllos – und warum reagiert der Durchschnittsbürger so apathisch?
Fast ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Präsidentschaft verströmt Donald Trump Rachsucht und Gewaltfantasien wie ein Verrückter. Indem er dem linksliberalen Filmregisseur Rob Reiner die Schuld an dessen Ermordung zuschreibt und eine Familientragödie in Hollywood zur Selbstverherrlichung missbraucht, hat Trump’s maligner Narzissmus eine neues Niveau erreicht. Doch dieser Vorfall ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe moralischer Grenzüberschreitungen, welche die Lust der MAGA-Anhänger an Grausamkeit befeuern – während sich traditionelle Republikaner kaum davon distanzieren. Warum kommt Präsident Trump mit rechtswidrigem Verhalten und einer verrohenden Sprache durch, wie sie noch vor wenigen Jahren in einem demokratischen Umfeld undenkbar schienen? Warum führt seine offenkundige Entgleisung nicht zu offenem Widerstand, spontanen Demonstrationen, neuen Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren oder einem dramatischen Umschwung in den Umfragen? Warum wirken seine politischen Gegner so ratllos – und warum reagiert der Durchschnittsbürger so apathisch?
Der Mord an dem bekannten und beliebten Filmregisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau durch den eigenen, psychisch belasteten Sohn zeigte auf erschreckende Weise, welches Maß an verbaler Gewalt Donald Trump bereit ist zu entfesseln – und wie weit er geht, um Kritiker seiner Politik des Zorns zu diffamieren. Für alle, die Trumps Reaktion auf seiner Plattform Truth Social nicht gelesen haben, lohnt sich ein Blick auf das vollständige Zitat:
„Letzte Nacht ereignete sich etwas sehr Trauriges in Hollywood. Rob Reiner, ein gequälter und mit sich kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist zusammen mit seiner Ehefrau Michele verstorben – Berichten zufolge infolge des Zorns, den er bei anderen ausgelöst hat, durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Besessenheit von einer geistig lähmenden Krankheit namens TRUMP-DERANGEMENT-SYNDROM, auch bekannt als TDS. Er war dafür bekannt, Menschen mit seiner wütenden Fixierung auf Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn zu treiben, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Regierung alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und das Goldene Zeitalter Amerikas anbrach – vielleicht wie nie zuvor. Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen.“
Dies ist der klare Fall eines offensichtlich entgleisten Menschen, der seinen kultivierten, meinungsstarken und nun toten Gegner als „verrückt“ pathologisiert. Kommentatoren der etablierten Medien sind sich weitgehend einig. „Wir werden von dem widerwärtigsten Menschen geführt, der je das Weiße Haus bewohnt hat“, schreibt Bret Stephens in der New York Times. Und New Yorker-Chefredakteur David Remnick fragt seine Leser: „Kennen Sie jemanden, der auch nur annähernd so bösartig ist? An Ihrem Arbeitsplatz? Auf Ihrem Campus? Einen Kollegen? Einen Lehrer? … Sind Sie jemals in Ihrem Leben einer so erbärmlichen Figur wie Donald Trump begegnet?“
Dabei konnte man es kommen sehen. Trumps Litanei abwertender Aussagen über Frauen, Soldaten und Journalisten ist lang. Von seiner Zeit als vulgärer Immobilienmogul in New York über die Wahlkämpfe bis hin zu seinen Präsidentschaften hat er Frauen als „Pferdegesicht“, „fette Schweine“, „Schlampen“, „ekelhafte Tiere“ beschimpft – und zuletzt als „Schweinchen“, als eine Journalistin ihm eine kritische Frage stellte. US-Soldaten, die im Einsatz gefallen sind, bezeichnete Trump als “Verlierer“ und „Trottel“. Über den Kriegsveteranen und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten John McCain, der fünf Jahre in nordvietnamesischer Kriegsgefangenschaft verbracht hatte, sagte er, er bevorzuge „Menschen, die nicht gefangen genommen wurden“. Journalisten und Medien, deren Berichterstattung ihm missfällt, diffamiert er regelmäßig als „Feinde des Volkes“. „Dinge passieren nun mal“, kommentierte Trump die Ermordung des Washington Post-Journalisten Jamal Khashoggi durch saudische Geheimdienste im Jahr 2018, als er den saudischen Herrscher Mohammed bin Salman jüngst im Weißen Haus empfing, um über künftige Deals mit einem Autokraten seines Geschmacks zu sprechen.
Die Gewohnheit, Frauen, Schwache und politische Gegner zu entmenschlichen, Gewalt zu tolerieren oder gar zu propagieren, ist also seit Trumps Eintritt in die Unterhaltungs- und Politikarena sichtbar. Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit begnadigte er 1.500 Aufständische, die am 6. Januar 2020 das Kapitol gestürmt hatten, um den Wahlsieg Joe Bidens zu kippen. Ein Präsident, der Schwerverbrecher, Drogenbosse und korrupte Geschäftsleute willkürlich freilässt, untergräbt die moralische Grundlage des Rechtssystems.
Die Akzeptanz von Gewalt als rhetorischem und politischem Mittel hat sich in der MAGA-Bewegung – und darüber hinaus – festgesetzt. Ein aufschlussreiches Beispiel ist die frühere Fox-Moderatorin Megyn Kelly, die vom Opfer zur Fürsprecherin gewalttätiger Rhetorik wurde. Nachdem sie Trump im August 2024 in einem Fox-Interview herausgefordert hatte, reagierte er auf CNN mit einem üblen Spruch, bei ihr komme „Blut aus allen möglichen Öffnungen“. Heute attackiert Kelly als Gastgeberin ihrer eigenen Sendung The Megyn Kelly Show politische Gegner innerhalb und außerhalb der MAGA-Bewegung in ähnlich herabsetzender Weise.
Die Brutalisierung der Sprache ist zum integralen Bestandteil des Geschäftsmodells von Podcastern wie Kelly und offen faschistischen Influencern wie Nick Fuentes geworden – verkauft als Ausdruck von Meinungsfreiheit und „Authentizität“. Angetrieben wird dieses Modell von den US-Tech-Oligarchen, autoritären Charakteren in libertärem Gewand, die versuchen, dieses System grenzenloser, industriell produzierter Polarisierung jetzt auch europäischen Gesellschaften aufzuzwingen.
Die vermeintliche „Authentizität“ ist der Punkt, an dem das Angebot an Gift und Galle aus dem Umfeld Trumps auf eine öffentliche Nachfrage nach einfachen Antworten auf komplexe, lange gährende Probleme trifft. Wenn Hass algorithmisch in die Filterblasen sozialer Medien eingespeist wird, fällt es insbesondere jungen Männern leicht, sich aus gefühlter Kränkung und Diskriminierung zu „befreien“, indem sie Gewalt gegen jene propagieren, die sie für ihre Lage verantwortlich machen – Frauen, Migranten, nicht-weiße Menschen. Früher pöbelten solche Männer die Schwächeren in der Dorfkneipe an. Heute nutzen sie Plattformen wie X, um ihre Vorurteile millionenfach zu verbreiten – und fühlen sich dadurch bestätigt.
Donald Trump ist dabei gleichzeitig Katalysator und Verkörperung dessen, was sich in den vergangenen zehn Jahren im digitalen wie im analogen Raum vollzogen hat: eine erschreckende Akzeptanz von Gewalt, von Handlungen und Grenzüberschreitungen, die zuvor undenkbar waren. Zugleich sind die USA zu einer Gesellschaft mit vielen vereinsamten, selbstbezogenen Bürger geworden – Ressentiment-geladen oder einfach nur abgestumpft.
Der Glaube, eine solche Rückkehr gewalttätiger Rhetorik und autoritärer Praxis sei unmöglich, markiert ein konzeptionelles Versagen des Liberalismus. Es beginnt mit einer Politikwissenschaft, die bis heute „den Trumpismus nicht begreift“, wie Jason Blakely in einem bemerkenswerten Essay in Harper’s schreibt. Die datengetriebenen Theorien der Sozialwissenschaften und Meinungsforschungsinstitute, dem Vertrauen des Liberalismus auf Institutionen verhaftet, konnten – so Blakely – die „dramatische ideologische Mutation von MAGA nach Rechtsaußen nicht erklären: eine hausgemachte Fusion aus Promikult, neoliberaler Bosskultur, christlichem Nationalismus und autokratischen Vorstellungen exekutiver Macht”.
Das Versagen setzte sich fort bei Leitmedien, deren Journalisten glaubten, es reiche aus, Trumps der Lügen zu überführen, um seine Unwürdigkeit offenkundig zu machen. Es wurde ergänzt durch eine Justiz, deren liberale Vertreter die „Unitary Executive Theory“ nur für eine abwegige Auslegung der Verfassung durch einige erzkonservative Richter hielten – statt für einen direkten Pfad in die Autokratie. Und es kulminierte im aufrichtigen, aber naiven Glauben der Demokratischen Partei an einen Wandel durch die richtigen Politikvorschläge. Was Technokraten und professionelle Eliten in den zentralen Institutionen des Landes nicht begreifen wollten war, dass die Männer und die Bewegung hinter Trump bereit waren, mit der ideologischen Welt des Liberalismus mitsamt ihren Regeln und Normen zu brechen.
Der Irrglaube endete bei jenen Wählern, die die Gefahren ihrer Stimmabgabe für Donald Trump mit Ausflüchten kleinredeten: „Trump ist eben Trump“ oder „er sagt das doch nur“. Doch er handelt eben auch danach! Und dennoch würden laut aktuellen Umfragen selbst heute bis zu 40 Prozent der Erwachsenen und 70 Prozent der republikanischen Basis erneut für Donald Trump stimmen – für einen ekelhaften und entgleisten Möchtegern-Autokraten.
Doch wenn schon die liberale Elite das Phänomen Trump und MAGA nicht zu fassen vermochte – wie sollte es dann der Durchschnittswähler in Kansas besser wissen? Während Trumps rechte Basis seine gewalttätigen Abweichungen vom liberalen Regelwerk feiert, gingen viele republikanische Wähler schlicht aus allgemeiner Unzufriedenheit zur Wahlurne, ohne die langfristigen Folgen für die Gesellschaft zu erkennen, in der sie leben. Und manche von ihnen könnten es wieder tun – komme, was wolle.
Diese wachsende Akzeptanz von Gewalt und die Sehnsucht nach autoritärer Herrschaft sind kein rein amerikanisches Phänomen. Von Chile bis Indonesien gewinnen Anhänger ehemaliger Diktatoren Wahlen. Die einzige Demokratie im Nahen Osten rückt dramatisch nach rechts. Die EU leidet unter einem illiberalen Backlash. MAGA-ähnliche Rechtsparteien stehen in zahlreichen Ländern vor Wahlsiegen und Regierungsbeteiligungen. Und überall treiben soziale Medien diese Entwicklungen voran – wie in den USA. Die Rückkehr rechter, gewaltaffiner Politik ist global.
Und doch ist Donald Trump einzigartig: mit seinen performativen Fähigkeiten als unterhaltsamer Rächer, seiner nahezu vollständigen Dominanz des medialen Raums und seiner Position an der Spitze einer Weltmacht. Mit Trump’s sich andeutendem politischen Niedergang könnte sich das „Inferno des Hasses“ (The Atlantic) sogar noch steigern – und seinen radikalen Anhängern weiteren Freiraum geben, ihre Überlegenheitsgefühle gegenüber jenen Gruppen auszuleben, denen sie ihren gefühlten Statusverlust anlasten.
In diesem Sinne mag Trumps widerwärtiger Kommentar zum Mord an einem liberalen Hollywood-Regisseur nur der nächste Schritt zu einer weiteren Herabsetzung amerikanischer Normen und Werte gewesen sein. Mehr als jede einzelne politische Untat, jede Lüge oder jeder Korruptionsskandal wird diese Entwertung der amerikanischen Demokratie Donald Trumps dauerhaftes Vermächtnis sein.
Frohe Weihnachten – und ein besseres Jahr 2026 für uns alle.
(Bild: Präsident Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus im Februar 2025; Dan Scavino, Public Domain via Wikimedia Commons)
“Make Europe great again” - in MAGA’s Image
„Make Europe Great Again“ – durch Verunglimpfung seiner Regeln und Werte. So lautet der zentrale Schlachtruf der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) von Donald Trump vom 4. Dezember. „America First“ macht damit die Neuerfindung Europas in MAGA’s Image zu einem neuen Ziel US-amerikanischer Geopolitik. Der Rest der 33-seitigen Schrift fällt gedanklich ins 19. Jahrhundert zurück, indem die Welt erneut in Einflusssphären aufgeteilt wird. Die einst beschworene Bedrohung durch China schrumpft zur bloßen wirtschaftlichen Konkurrenz. Russland wird gestattet, zu seinen sowjetischen oder gar imperialen Wurzeln zurückzukehren. Und die „westliche Hemisphäre“ gehört – wie eh und je – den Vereinigten Staaten, nun unter einer aufgemotzten Version der Monroe-Doktrin von 1823. Dass der starke Mann im Weißen Haus als ehemaliger Immobilien-Hai die Welt in Parzellen aufzuteilen will, die dann von den dortigen Herrschern ausgebeutet werden können, überrascht kaum. Doch woher rührt Trumps – und MAGAs – tiefe Verachtung für Europa?
„Make Europe Great Again“ – durch Verunglimpfung seiner Regeln und Werte. So lautet der zentrale Schlachtruf der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) von Donald Trump vom 4. Dezember. „America First“ macht damit die Neuerfindung Europas in MAGA’s Image zu einem neuen Ziel US-amerikanischer Geopolitik. Der Rest der 33-seitigen Schrift fällt gedanklich ins 19. Jahrhundert zurück, indem die Welt erneut in Einflusssphären aufgeteilt wird. Die einst beschworene Bedrohung durch China schrumpft zur bloßen wirtschaftlichen Konkurrenz. Russland wird gestattet, zu seinen sowjetischen oder gar imperialen Wurzeln zurückzukehren. Und die „westliche Hemisphäre“ gehört – wie eh und je – den Vereinigten Staaten, nun unter einer aufgemotzten Version der Monroe-Doktrin von 1823. Dass der starke Mann im Weißen Haus als ehemaliger Immobilien-Hai die Welt in Parzellen aufzuteilen will, die dann von den dortigen Herrschern ausgebeutet werden können, überrascht kaum. Doch woher rührt Trumps – und MAGAs – tiefe Verachtung für Europa?
Erstens wird sie von einem Präsidenten vorgegeben, der Schwäche verachtet, sich von Geschichte nicht gebunden fühlt, sich selbst für zu groß hält, um Verbündete zu brauchen, und der keine moralischen Maßstäbe kennt. Kurz: einem Darwinisten, Transaktionalisten, Narzissten und Nihilisten – einem Führer, dem alle Eigenschaften fehlen, die es braucht, um eine Demokratie zu führen.
Zweitens wurde diese Nationale Sicherheitsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem engen Kreis ideologischer Berater verfasst, ohne Einbindung von erfahrenen Beamten oder gar Diplomaten. Anders als die Sicherheitsstrategie seiner ersten Amtszeit, die sich noch in den stetigen Rückzug der jüngeren US-Außenpolitik einfügte, markiert das neue Dokument einen radikalen Bruch mit dem bisherigen amerikanischen Weltbild – und eine so selbstbeweihräuchernde (man lese nur Trumps zweiseitige Einleitung!) wie skrupellose Neuverortung der USA in der Welt.
Dieser deutliche Unterschied zwischen der NSS von 2017 und jener vom Dezember 2025 spiegelt den Weg von der ersten zur zweiten Trump-Administration wieder – und den Übergang von MAGA 1.0 zu MAGA 2.0. In der ersten Amtszeit hatten die radikalen Kräfte an Trumps Seite festgestellt, dass wirkliche Macht und der angestrebte Wandel von einer liberalen zu einer illiberalen Hegemonie mehr erfordern, als bloß andere Politikvorschläge. Da Macht in Institutionen verankert ist, mussten auch diese verändert werden: von Behörden über Kanzleien bis hin zu Universitäten und Medien. Genau das ist das Drehbuch von Trump II – mit dem DOGE-Experiment, Racheanklagen gegen frühere Staatsanwälte, Angriffen auf Eliteuniversitäten und Drohungen gegen kritische Traditionsmedien.
Wer glaubt, liberale Schwäche liege vor allem in Regeln und Institutionen begründet, überträgt diese Sicht zwangsläufig auch auf die Außenpolitik. Und dann sieht man in Europa nur das, was man im eigenen Land hasst. Durch diese Brille erscheint die „alte Welt“ als Bastion des Liberalismus und als Hölle einer vermeintlich „woken“ Kultur – ungeachtet der Tatsache, dass der Begriff des „Wokismus“ selbst eine amerikanische Verzerrung französischer Philosophie darstellt. Man glaubt dann, wie Donald Trump, Europa sei einzig geschaffen, um die USA „zu bescheißen”.
Man kann all die Provokationen, Auslassungen und Widersprüche dieser Europapolitik aufzählen. Die neue Bibel des „America First“ will „auf der eurasischen Landmasse die Bedingungen strategischer Stabilität wiederherstellen“ – eine Formulierung, die Wladimir Putin kaum besser hätte wählen können. Anders als im vorhergehenden Dokument fehlt in der neuen NSS jeglicher Verweis auf Menschenrechte. Sie tadelt die EU für eine zu lasche Migrationspolitik, während die USA selbst früher eine nicht-weiße Bevölkerungsmehrheit haben werden als die meisten europäischen Staaten. Manche würden dies als Projektion eigener Ängste bezeichnen. Die Strategie predigt Nicht-Interventionismus und empfiehlt zugleich eine gezielte Einmischung in europäische Politik, indem man „Widerstand gegen Europas gegenwärtigen Kurs innerhalb europäischer Nationen kultiviert“. Das heißt, die nationale Souveränität der Vereinigten Staaten soll durch Eingriffe in die Souveränität anderer Länder verteidigt werden.
Doch das bloße Aufzeigen fehlender Wertevorstellungen und mangelnder Kohärenz in diesem provokanten, aber ehrlichen Dokument hilft Europa wenig angesichts seiner Abhängigkeit von den USA und seiner prekären globalen Lage. Aus europäischer Sicht erscheint es sinnvoller, die Kräfte in den USA zu analysieren, die diese Positionen vertreten, um die dahinterstehenden Interessen zu verstehen: Welche Elemente dieses Konvoluts aus Fakten, Fiktionen und Halbwahrheiten sind populär genug, um die zweite Trump-Administration zu überdauern – und warum?
Die NSS versucht, jeder Fraktion der Koalition, die Trump zweimal ins Weiße Haus getragen hat, etwas zu bieten. Den Isolationisten verspricht sie den Rückzug aus der traditionellen Rolle als Weltpolizist. Die China-Hardliner erhalten zumindest eine abgeschwächte Bestätigung der Sicherheitsgarantie für Taiwan. Der Rückzug aus dem Nahen Osten öffnet Spielräume für Deal-Maker innerhalb und außerhalb der Präsidentenfamilie. Der verbliebenen weißen Arbeiterklasse verspricht die Zollpolitik eine Rückkehr der Industrie ins amerikanische Kernland. Die Deregulierungsrhetorik ist das Geschenk an die Tech-Brüder im Silicon Valley. Und der Export des Kulturkampfes nach Europa bedient die christlich-nativistische, anti-woke Fraktion um Steve Bannon und Vizepräsident J. D. Vance.
Zwischen diesen Gruppen gibt es weiterhin genügend Konfliktstoff. Doch Trump hat innerkoalitionäre Streitereien stets als Mittel zur Machtsicherung genutzt, und es ist unwahrscheinlich, dass die Allianz ausgerechnet an Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik zerbricht. Hinter der inhaltlichen Inkohärenz und den kleinteiligen Versprechungen liegt die eigentliche Kunst dieser NSS – und der trumpistischen Politik insgesamt: die Verbindung von Narrativ und Zweck, die Verschmelzung kultureller „weicher“ Themen mit handfesten politischen Interessen, das Schüren von Emotionen, um Ausbeutung und Abschöpfung zu verschleiern.
Der eigentliche Grund, warum Europa – der vermeintliche Verbündete – stärker unter amerikanischem Beschuss gerät als traditionelle Gegner, liegt darin, dass die EU der letzte Teil der alten Ordnung ist, der am Rechtsstaat festhält und versucht, die Dominanz der US-Techindustrie zu begrenzen. Deshalb wurde Microsoft von der US-Regierung gezwungen, die E-Mails des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Ahmad Khan, abzuschalten. Und deshalb löste eine lächerliche 140-Millionen-Dollar-Strafe der EU gegen Elon Musk wegen Verstößen seiner Plattform X einen Sturm der Entrüstung aus Trumps Kabinett aus. Da der wirtschaftliche Vorsprung der USA gegenüber Europa maßgeblich auf der Macht der Techindustrie und ihrer Wette auf Künstliche Intelligenz beruht, folgt Trump’s Politik den Forderungen der Oligarchen des Silicon Valley. Ihnen in einem Europa von Vasallenstaaten freie Hand zu lassen, ist Teil dieses Deals.
Ob die MAGA-Koalition die Zwischenwahlen im November 2026 übersteht, ist offen. Die US-Demokraten sollten versuchen, die zunehmenden innenpolitischen Probleme und die weitverbreitete Skepsis gegenüber KI mit Trumps umstrittener Politik zu verknüpfen, wie sie in der NSS formuliert wird. Und Europas Parteien der Mitte sollten die weitverbreitete Abneigung gegen Donald Trump, zusammen mit einer Verteidigung nationaler Souveränität „als Waffe gegen die Euro-MAGA-Bewegung“ einsetzen – wie Mark Leonard im Economist vorschlägt.
Doch all das wird schwierig. Fragt man den durchschnittlichen US-Wähler nach seiner Sicht auf Europa, lautet die Antwort meist: „Schöner Ort, aber sie sollten für ihre Verteidigung selbst zahlen.“ Es gibt noch immer eine sentimentale Bindung an die „alte Welt“, solange sie die „neue Welt“ wenig kostet. Meinungsumfragen zeigen zwar, dass über 60 Prozent der Amerikaner weiterhin die NATO, die Unterstützung der Ukraine und die Verteidigung Taiwans befürworten. Doch solche Befragungen gehen selten tiefer: „Und was, wenn man dafür zahlen muss?“
Legte man dem durchschnittlichen Wähler in den USA die sieben Stichpunkte der NSS zu den „Prioritäten“ der neuen Europapolitik vor, würden er oder sie diese vermutlich problemlos durchwinken – vielleicht mit Ausnahme des Punktes der „Kultivierung von Widerstand in Europa“. „Strategische Stabilität mit Russland…“ – abgehakt. „Europa befähigen, auf eigenen Füßen zu stehen…“ – warum nicht. „Offene europäische Märkte…“ – selbstverständlich. Europa zu Maßnahmen gegen „feindliche wirtschaftliche Praktiken“ bewegen – na klar. Anders gesagt: Die Trump-Koalition wird wegen dieses Dokuments kaum Wähler verlieren. Und auch die Demokratische Partei hätte es schwer, im Wahlkampf oder gar in Regierungsverantwortung grundlegend gegen diese Punkte zu argumentieren. Die gnadenlose Neuformulierung der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik in der NSS mag die liberalen Eliten auf beiden Seiten des Atlantiks aufschrecken. Doch die einzelnen Punkte entsprechen weitgehend den Gefühlen eines Großteils der US-Bevölkerung.
Die EU sollte die Kräfte hinter der Wortwahl dieser NSS daher ernst nehmen, sich auf einen anhaltenden Deregulierungsdruck aus dem US-Techsektor einstellen und nicht auf substanzielle Veränderungen der transatlantischen Beziehungen nach Trumps Abgang hoffen. Europa muss rasch lernen, auf eigenen Füßen zu stehen – wenn es Amerika nicht endgültig verlieren will.
Tansanias autoritäre Wende
Wie jedes Jahr hätten die Tansanier am 9. Dezember voller Stolz den Jahrestag ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1961 begangen. Und die Bürger hätten ihr ostafrikanisches Land wie immer dankbar als „Insel der Stabilität“ gefeiert. Doch seit der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Umfeld der Präsidentschaftswahl vom 29. Oktober dieses Jahres mit Hunderten, wenn nicht gar mehr als tausend Toten ist dieses Selbstbild tief erschüttert. Aus Angst vor weiteren Unruhen hat die Regierung jetzt alle Feierlichkeiten zum Independence Day abgesagt und die Sicherheitskräfte schon Tage vorher in Alarmbereitschaft versetzt. Auf der anderen Seite rufen junge Aktivisten über die sozialen Medien für den 9. Dezember zu neuen, friedlichen Protesten auf.
Wie jedes Jahr hätten die Tansanier am 9. Dezember voller Stolz den Jahrestag ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1961 begangen. Und die Bürger hätten ihr ostafrikanisches Land wie immer dankbar als „Insel der Stabilität“ gefeiert. Doch seit der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Umfeld der Präsidentschaftswahl vom 29. Oktober dieses Jahres mit Hunderten, wenn nicht gar mehr als tausend Toten ist dieses Selbstbild tief erschüttert. Aus Angst vor weiteren Unruhen hat die Regierung jetzt alle Feierlichkeiten zum Independence Day abgesagt und die Sicherheitskräfte schon Tage vorher in Alarmbereitschaft versetzt. Auf der anderen Seite rufen junge Aktivisten über die sozialen Medien für den 9. Dezember zu neuen, friedlichen Protesten auf.
Was war in dem ostafrikanischen Vorzeigestaat sozialer Harmonie geschehen? Als die Tansanier am Wahlmorgen des 29. Oktober mehrheitlich zu Hause blieben und Vertreter der Regierungspartei CCM (Chama Cha Mapinduzi) damit begannen, die Wählerlisten selbst auszufüllen, kam es in Dar-es-Salaam und anderen Städten zu spontanen, zum Teil auch gewaltsamen Protesten junger Leute. Als einige Demonstranten Wahllokale und Polizeistationen angriffen, reagierten die Sicherheitskräfte mit aller Härte.
Augenzeugen berichteten von gezielten Todesschüssen in den Straßen, aber auch bei der anschließenden Durchsuchung von Gebäuden. Kranken- und Leichenschauhäuser vermeldeten die Einlieferung von Verletzten und Toten. Auch von Massengräbern war die Rede. Manche Demonstranten und Vertreter der Zivilgesellschaft waren angesichts der Brutalität von Polizei und Sondereinsatzkräften so verzweifelt, dass sie an die Armee appellierten, die Macht im Staate zu übernehmen.
Nach der Sperrung des Internets für fünf Tage erklärte sich Präsidentin Samia Suluhu Hassan dann zur Wahlsiegerin, mit 97,66 % der Stimmen bei einer angeblichen Wahlbeteiligung von 87 %. Alle Vorwürfe gegen Regierung und Polizei wies sie entschieden zurück. Anschließend drohte die Regierung all denen, die über whatsapp und Instagram Informationen über die Opfer der staatlichen Gewalt verbreiteten, mit drastischen Strafen.
Der plötzliche Ausbruch von Gewalt in Tansania war beispiellos, kam aber nicht überraschend. Zwar hatte die jetzt im Amt bestätigte Präsidentin Samia Suluhu Hassan bei ihrem Amtsantritt nach dem plötzlichen Tod ihres Vorgängers John Pombe Magufuli 2021 eine Öffnung des erstarrten politischen Systems versprochen und dann auch eingeleitet. Doch als deutlich wurde, dass die Opposition die mehr als 60-jährige Alleinherrschaft der CCM bald ernsthaft gefährden könnte, wurden diese Reformansätze zurückgenommen und durch repressive Maßnahmen ersetzt. Nachdem er zum Wahlboykott aufgerufen hatte, wurde der Führer der Oppositionspartei Chadema, Tundu Lissu, verhaftet und im April des Hochverrats angeklagt, ein anderer Präsidentschaftsbewerber nicht zur Wahl zugelassen.
Als erste Frau im Präsidentenamt und von der halb-autonomen Insel Sansibar stammend, verfügte Samia Suluhu Hassan von Beginn an im Apparat der CCM nur über eine schwache Machtbasis. Manche Beobachter erklären ihre Wandlung zur autoritären Führungsfigur damit, dass sie sich vor der alteingesessenen, frauenfeindlichen und von Geheimdienstlern durchsetzten Führungsriege der CCM beweisen musste.
Tansanias Sicherheitsapparat, unter dem allseits verehrten Gründungspräsidenten Julius Nyerere in den 70er Jahren von der Stasi trainiert, hat schon immer die Geschicke des Landes mitbestimmt und wenn nötig politische Gegner der Regierungspartei gewarnt, gefoltert und verschwinden lassen. Im Juni dieses Jahres hatte eine Experten-Kommission der Vereinten Nationen die Zahl der „Verschwundenen“ seit 2019 auf über 200 geschätzt und das Vorgehen der Regierung als „inakzeptabel“ kritisiert.
Der prominenteste Fall war der von Humphrey Polepole, einem ehemaligen „Parteisekretär für Ideologie“, anschließend Botschafter in Kuba, der nach seinem Rücktritt im September die undemokratische Herrschaft der CCM in einem Brandbrief kritisiert hatte. Er wurde daraufhin Anfang Oktober gewaltsam aus seinem Haus entführt, ehe man seinen entstellten Körper am Strand von Dar-es-Salaam fand. Die Präsidentin war schon im Vorlauf zu den Wahlen von Polepole und anderen dafür kritisiert worden, dass sie ihrem Sohn Abdul Halim Hafidh Ameir die Führung einer informellen Spezialeinheit des Geheimdienstes TISS zur Unterdrückung von Oppositionellen übertragen habe. „Wenn mir etwas geschieht, hatte der Kritiker aus den eigenen Reihen drei Tage vor seiner Entführung in einem YouTube Video gewarnt, „wisst ihr, dass es die Regierung war“.
Die brutale Niederschlagung der Proteste ist von der katholischen Kirche Tansanias, von internationalen Medien, afrikanischen Wahlbeobachtern und Entwicklungspartnern des Landes heftig kritisiert worden. „Eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, eines der friedlichsten Länder Afrikas zu regieren, hatte ihren Tiananmen Square-Moment“, kommentierte der britische „Economist“ die blutige Jagd auf Demonstranten.
Die sonst in ihrem Urteil eher zurückhaltenden Beobachtermissionen der Afrikanischen Union und der Southern African Development Community (SADC) kritisierten die Wahlen und ihre Umstände in ungewohnt harschen Worten. Und das Europäische Parlament drängte die EU-Kommission dazu, Entwicklungsgelder in Höhe von 156 Millionen Euro einzufrieren. Einige Beobachter sahen sogar die geplanten Großprojekte der „East African Crude Oil Pipeline“ nach Uganda und die Gasbohrungen vor der Küste in Gefahr.
Doch es dauerte fast einen Monat, ehe die internationale Diplomatie auf die mittlerweile durch eine Recherche des US-Senders CNN bekräftigen Vorwürfe der Aktivisten mit Nachdruck reagierte. In einer gemeinsamen Erklärung vom 4. Dezember verweisen 16 europäische Botschaften in Tansania auf „glaubwürdige Berichte von inländischen und internationalen Organisationen mit Beweisen für außergerichtliche Tötungen, Entführungen, willkürliche Festnahmen und die Beseitigung von Leichen” - und fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen.
Am gleichen Tag kündigte das US-amerikanische Außenministerium eine “grundsätzliche Überprüfung” des Verhältnisses zu Tansania an, weil die “jüngsten Handlungen der Regierung Fragen zur Richtung der bilateralen Beziehungen aufwerfen”. Nachdem das Vakuum der an “America First” ausgerichteten Afrika-Politik Donald Trumps von einigen Regimen als Lizenz zu repressiver Regierungsführung verstanden wurde, scheint man jetzt im US-State Department bemerkt zu haben, dass ein endgültiges Abdriften Tansania’s in das autokratiefreundliche Lager des Groß-Investors China zu Amerika’s Schaden sein könnte.
Samia Suluhu Hassan hat auf die Vorwürfe bisher mit einer Mischung aus Leugnung und Reue, Härte und Konzilianz reagiert. Erst wurden 240 Demonstranten des Hochverrats angeklagt, dann wieder 139 Festgenommene freigelassen. Anfangs wies sie alle Anschuldigungen gegen die Polizei zurück, später gab sie die Einsetzung einer achtköpfigen Untersuchungskommission bekannt. Um die schockierten Tansanier und aufgebrachten Partner im Ausland zu beruhigen, hat sie die Opposition nun zu Dialog und Versöhnung aufgefordert. Doch nach dem absoluten Vertrauensverlust der Regierung dürfte sich kein aufrechter Oppositioneller auf solche Angebote mehr einlassen.
Die Bestellung ihres Kabinetts lässt darauf schließen, dass Hassan die Reihen der CCM eher schließen als öffnen will. Nicht Reformer, sondern Familienmitglieder wurden neu in die Regierung einberufen. Ihre Tochter Wanu Hafidh Ameir ist nun Vize-Ministerin für Bildung, und deren Ehemann wurde zum Gesundheitsminister ernannt. Beide verfügen so über beträchtliche Budgets. Ihr Sohn Abdul Halim Hafidh Ameir soll schon länger eine informelle Sondereinheit des Geheimdienstes TISS zur Unterdrückung von Oppositionellen kommandieren.
Damit folgt jetzt auch Tansania unter Präsidentin Hassan dem Muster autoritärer Regime wie dem im Nachbarstaat Uganda: während die Söhne die Kontrolle über Militär und Sicherheitskräfte an sich reißen, bedienen sich die Geschwister, Töchter und Schwiegersöhne in den zivilen Bürokratien des Staatsapparates.
Bisher hatten sich die meisten Tansanier trotz des 1992 eingeführten Multiparteiensystems mit der Alleinherrschaft einer faktischen Einheitspartei abgefunden, welche die Ausübung von Gewalt durch die Sicherheitsdienste nur sporadisch als exemplarische Warnung zuließ. Jeder Tansanier wusste, wer an seinem Arbeitsplatz als Informant für den Geheimdienst fungierte. Dieses soziale Netzwerk gegenseitiger Überwachung war die Schattenseite des sonst erfolgreichen nation building unter dem „Landesvater“ Julius Nyerere, das der Vereinigten Republik Tansania die in den Nachbarländern virulenten ethnischen Spaltungen erspart hat.
Doch in einem Land von über 62 Millionen Einwohnern, von denen 70 % jünger als 35 Jahre sind, über 70% im informellen Sektor arbeiten und in dem viele Jugendliche arbeitslos sind, verlangt heute eine wachsende Anzahl der Bürger nach demokratischer Teilhabe und einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Doch wie in zahlreichen afrikanischen Staaten trifft diese „Generation Z“ auch in Tansania auf eine längst korrumpierte Führung aus den alten Kämpen der Befreiungsbewegung und auf eine in Familienverbünden operierende Elite, deren einträgliches Leben nicht in größeren Widerspruch zum prekären Alltag der Jugend stehen könnten.
Mit dem allzu offensichtlichen Wahlbetrug und der brutalen Unterdrückung der Proteste scheint die ewige Regierungspartei CCM nun endgültig eine autoritäre Wende vollzogen zu haben. „Der als Demokratie verkleidete Einparteienstaat“ (International Crisis Group) kann seinen Verlust an Legitimation offenbar nur noch mit offener Repression bekämpfen. Eine internationale Allianz von Anwälten und Menschenrechtsgruppen hat jetzt den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ersucht, den Vorwurf von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Präsidentin Hassan und ihre Regierung zu untersuchen.
Ob die Proteste der tansanischen Generation Z nach dem 29. Oktober erst einmal erstickt worden sind, oder sich am offiziell abgesagten Tag der Unabhängigkeit fortsetzen werden, bleibt eine offene Frage. Aber die Chancen, dass die Regierungspartei CCM unter Samia Suluhu Hassan die seit langem versprochene Reform des politischen Systems endlich ernsthaft angehen wird, stehen nicht zum Besten.
Die Zukunft von MAGA nach Donald Trump
Man hätte kaum erwartet, dass ausgerechnet eine waffenbefürwortende, streng christliche, gegen Muslime und Juden hetzende, für „weiße Männer“ und das „ungeborene Leben“ kämpfende dreifache Mutter und glühende MAGA-Anhängerin die erste wahre Rebellin unter Donald Trumps Präsidentschaft sein würde. Eine Politikerin, die in der Vergangenheit behauptete, die Welt werde von einem Netzwerk satanischer, von George Soros finanzierter und von Hillary Clinton unterstützter Pädophiler kontrolliert. Doch genau diese radikale Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hat mit einem eindrucksvollen, elfminütigen Video den Präsidenten herausgefordert – und damit die tiefen Risse innerhalb der rechten Bewegung sichtbar gemacht. Risse, die die Frage aufwerfen, welche Zukunft “Make America Great Again” nach Donald Trump überhaupt noch hat.
Man hätte kaum erwartet, dass ausgerechnet eine waffenbefürwortende, streng christliche, gegen Muslime und Juden hetzende, für „weiße Männer“ und das „ungeborene Leben“ kämpfende dreifache Mutter und glühende MAGA-Anhängerin die erste wahre Rebellin unter Donald Trumps Präsidentschaft sein würde. Eine Politikerin, die in der Vergangenheit behauptete, die Welt werde von einem Netzwerk satanischer, von George Soros finanzierter und von Hillary Clinton unterstützter Pädophiler kontrolliert. Doch genau diese radikale Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hat mit einem eindrucksvollen, elfminütigen Video den Präsidenten herausgefordert – und damit die tiefen Risse innerhalb der rechten Bewegung sichtbar gemacht. Risse, die die Frage aufwerfen, welche Zukunft “Make America Great Again” nach Donald Trump überhaupt noch hat.
Die unterschiedlichen Strömungen innerhalb von MAGA existieren schon länger, doch erst jetzt treten sie offen zutage: „America First“-Anhänger, die Trumps Außenpolitik missbilligen – ob Finanzhilfen für Argentinien, Kriegsschiffe gegen Venezuela oder sein Engagement im Nahen Osten; Tech-Milliardäre, die die Anwerbung hochqualifizierter ausländischer Fachkräfte fordern, während das Weiße Haus einen erbitterten Feldzug gegen alle Immigranten führt; reuige Konservative, die inzwischen die wachsende Toleranz der Bewegung gegenüber offen faschistischen und antisemitischen Influencern kritisieren; und die zunehmende Zahl von MAGA-Anhängern, die realisieren, dass auch sie den Preis für Trumps erratische und schädliche Zollpolitik zahlen müssen.
Und dann ist da der immer erbitterter geführte interne Kampf um die Veröffentlichung der „Epstein Files“ – jener Dokumente über skandalöse Verfehlungen eines elitären Netzwerks aus Pädophilen und Mitläufern, Republikanern wie Demokraten. Marjorie Taylor Greene ist dabei nur die lauteste Stimme, die kompromisslos die vollständige Veröffentlichung fordert.
Wo also kommt MAGA her – und wohin steuert die Bewegung? Viele der rechten Positionen, die heute unter ihrem Namen zirkulieren, existieren seit Jahrzehnten. Sie wurden von konservativen Denkern wie William F. Buckley Jr. oder Allan Bloom formuliert und von Randfiguren der Republikanischen Partei wie David Duke oder Pat Buchanan in Wahlkämpfen der frühen 1990er-Jahren politisch aufgegriffen. Es folgten George W. Bushs teure „Forever Wars“ der 2000er-Jahre und die Finanzkrise von 2008. Zunehmend wurden die sozialen Kosten der Globalisierung und kulturelle Veränderungen als Versagen eines neoliberalen Systems wahrgenommen – verstärkt durch das „Problem“ der Massenmigration. Genau diese weit verbreitete, aber politisch unbeantwortete Entfremdung nutzten zunächst die Tea Party und später Donald Trump mit populistischem Instinkt und politischem Gespür.
In ihrem faszinierenden Buch „Furious Minds“ beschreibt Laura K. Field die zahlreichen Fraktionen, die im MAGA-Universum zusammenfanden: die „Claremonter“, konservative Intellektuelle aus dem gleichnamigen think tank, die an die amerikanischen Gründungsmythen anknüpfen; die überwiegend katholischen “Postliberalen”; die christlichen Nationalisten; und die Techno-Futuristen des Silicon Valley. Trumps Genie bestand darin, diese alten und neuen Strömungen der politischen Rechten in einer Zeit fundamentaler Veränderungen in Medien, Wirtschaft und politischer Kultur unter einer einzigen Marke zu bündeln – MAGA – und so die öffentliche Unzufriedenheit zu kanalisieren.
Eine aktuelle NBC-Umfrage zeigt, dass sich weiterhin 30 Prozent der US-Bevölkerung mit der Bewegung identifizieren, die Donald Trump für sich beansprucht. Auf die Frage nach seinen ständigen Kurswechseln in konservativen Positionen erklärte er kürzlich in einen TV-Interview: „Vergesst nicht: MAGA war meine Idee. MAGA war die Idee von niemand sonst. Niemand weiß besser als ich, was MAGA will.“ Doch mit „MAGA c’est moi“ – was bleibt dann von der Bewegung ohne ihren selbsternannten König? Oder anders formuliert: Wenn der Präsident zunehmend unter Druck gerät und selbst republikanische Abgeordnete nicht mehr blind seinen Befehlen folgen, stellt sich für die Bewegung unter einem politisch geschwächten Präsidenten im Weißen Haus die Frage: Wie geht es weiter?
Es gibt verschiedene Sichtweisen auf MAGAs Erfolg und Fragilität. Man kann die Bewegung, wie Jonathan Chait in The Atlantic, im Vergleich zum klassischen Konservativismus für „hirntot“ erklären. Oder man betont – wie George Packer im selben Magazin – im Vergleich zu einer fehlenden liberalen Antwort MAGA’s intellektuelle Energie der vergangenen Jahre. Der Autor Marc Lilla beschreibt drei mögliche Deutungen des MAGA-Phänomens: als „Vollendung der konservativen Bewegung“, als „Verrat am traditionellen Konservatismus“ oder als „gleichzeitigen Stoß eines gewaltigen kulturellen Sturms, der im Westen wütet und Errungenschaften von Jahrhunderten hinwegfegt“. In einem sind sich alle einig: Der politische Erfolg von MAGA geht einher mit einem tiefen moralischen Verfall und der Entmenschlichung des politischen Gegners.
Eine Bewegung wie MAGA braucht eine Ideologie. Doch unter einem Präsidenten, der die Realität nach Belieben beugt, verlieren Begriffe wie Nationalismus, Nativismus, Isolationismus, Protektionismus oder Techno-Feudalismus ihre Bedeutung – und damit ihre Bindekraft für einzelne Fraktionen. Dies zeigt sich etwa in dem internen Konflikt über „Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz “, der laut Economist „der vielleicht der folgenreichste ist. Während die KI-“Beschleuniger” im Silicon-Valley die totale Deregulierung fordern, warnen die moralgetriebenen “Entschleuniger” in der Bewegung vor Jobverlusten und kulturellem Verfall. Solche Spaltungen führen zu einem Grundproblem der Bewegung: Sollen die Anhänger ihre Überzeugungen verteidigen – oder ihren Anführer? Während Trumps politische Zeit abläuft, müssen Republikaner entscheiden, wo im künftigen konservativen Spektrum sie sich aufstellen wollen.
Diese Positionierung wird mit jeder Niederlage des Präsidenten im Kongress und vor Gericht dringlicher. Man sieht dies in Marjorie Taylor Greenes Rücktritt aus dem Repräsentantenhaus und in den Manövern potenzieller Präsidentschaftskandidaten, die um die Gunst des amtierenden Vizepräsidenten buhlen, der während des Niedergangs Trumps einflussreichsten Figur im republikanischen Lager. Auch wird spannend zu beobachten sein, wie MAGA-Anhänger den Weg zurück aus einer Welt der Verschwörungen, Wunschvorstellungen und vereinfachenden Dogmen in eine komplexe, diverse amerikanische Realität finden. Wenn überhaupt. Rückkehr zur Realität – oder weitere Radikalisierung? Die Frage bleibt offen.
Für manche wird das Verlassen der MAGA-Welt ein langer und schmerzhafter Prozess sein, wie Richard Loges zu berichten weiß. Der ehemalige Verfechter der Bewegung benötigte Jahre, um seine politische Verirrung einzugestehen. „Die ständige Diät aus MAGA-Medien“ habe ihn in den konservativen Abgrund geführt, sagt er. Erst „die Diversifizierung seiner Informationsquellen“ habe ihm vor Augen geführt, dass er „in der MAGA Bewegung seine Menschlichkeit verloren hatte”.
Viele werden ihre Radikalisierung jedoch nie reflektieren. Die Mehrheit der enttäuschte MAGA-Wähler dürfte sich politisch einfach zurückziehen – auch weil die Demokraten bislang keine überzeugende Erzählung für jene anbieten, die das Spielfeld eines regelbasierten und zivilen Zweiparteiensystems verlassen haben. Hinzu kommt, dass die Übernahme traditioneller Medienhäuser durch rechte Milliardäre die Verbreitung einer liberale Gegen-Erzählung immer schwieriger macht.
Manche ehemalige oder aktuelle Hardliner könnten versuchen, einen neuen Populismus zu entwickeln, der „America First“ mit einer progressiveren Sozialpolitik verbindet – ein Ansatz, den sowohl Marjorie Taylor Greene als auch Steve Bannon bereits antesten. Möglicherweise gäbe es hier sogar Schnittmengen mit linken Politikern, die außenpolitischen Isolationismus mit wirtschaftlichem Populismus kombinieren wollen, denn politische Erfolge in den USA werden ohne Antworten auf die „Bezahlbarkeitskrise“ kaum noch möglich sein.
Andere extremistische Stimmen aus der rechten Blogosphäre könnten sich an den weißen, christlichen Nationalismus anlehnen, wie er von Vizepräsident J.D. Vance vertreten wird. Doch eine von dieser Strömung dominierte Republikanische Partei dürfte an den Wahlurnen kaum mehrheitsfähig sein. Um die Zukunft amerikanischer Politik bestimmen zu können, müssten diese extremen Nationalisten demokratische Institutionen erst noch weiter beschädigen – nicht völlig ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Bis 2028 könnten sie trotzdem großen gesellschaftlichen Schaden anrichten.
Eines ist in der politisch instabilen Phase unter einem “schrumpfenden” Präsidenten jedoch bereits sicher: Nach Trump wird es keine Rückkehr zur Politik von gestern geben – weder für Republikaner noch für Demokraten. Die „Grand Old Party“ wird sich nach ihrer Kapitulation vor Trump und seiner Kabale aus korrupten und kriminellen Gefolgsleuten grundlegend neu erfinden müssen. Die Demokraten wiederum müssen Wege finden, die schwer beschädigten Institutionen wieder aufzubauen und dabei gleichzeitig zu reformieren – damit „der Staat“ effizienter wird und von allen Bürgern akzeptiert werden kann. Neben einer entschiedeneren Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und öffentlichen Institutionen muss die Demokratische Partei aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, vor allem dem fehlenden Blick für das Bedürfnis vieler Menschen nach Respekt und Zugehörigkeit.
Doch die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe der Politik nach Trump wird sein, die die online wie offline propagierte Kultur der Gewalt, der Wut, der Bigotterie, der Häme, der Erniedrigung und Entmenschlichung wieder einzudämmen. Und um ehrlich zu sein: derzeit weiß niemand, wie das gelingen soll.
Trump, McNamara und der Preis der Loyalität
“Seditious behavior, punishable by death“ – „Aufrührerisches Verhalten, mit dem Tode zu bestrafen“ – postete Donald Trump diese Woche auf seiner Plattform „Truth Social“. Der angeschlagene Präsident reagierte damit auf ein Video, in dem sechs demokratische Abgeordnete mit sicherheitspolitischem Hintergrund Angehörige der US-Streitkräfte daran erinnerten, dass sie keine illegalen Befehle befolgen müssen. Oder anders gesagt: Der US-Präsident, der das Militär stärker politisiert hat als jeder seiner jüngeren Amtsvorgänger – und der sich als junger Mann mit fragwürdiger Begründung dem Wehrdienst entzog – wirft sechs Mitgliedern des Kongresses, die allesamt in Armee, Luftwaffe, Marine oder CIA gedient haben, Hochverrat vor, weil sie auf den Uniform Code of Military Justice und die US-Verfassung verweisen. Dort steht festgeschrieben, dass Soldatinnen und Soldaten illegalen Befehlen nicht folgen dürfen und einen Eid auf die Verfassung leisten – nicht auf den Präsidenten. Dieser heftige Schlagabtausch im toxischen Klima der aktuellen US-Politik wirft die Frage nach dem Preis der Loyalität auf.
Die Frage, wie Parlamentarier, hochrangige Beamte und Militärführer reagieren, wenn der Präsident und Oberbefehlshaber fragwürdige, verantwortungslose oder offensichtlich illegale Entscheidungen trifft, sorgte bereits für eine unterschwellige Debatte während der ersten Trump-Amtszeit – als einige der sogenannten „Erwachsenen im Raum“ wie der Nationale Sicherheitsberater H.R. MacManus oder Verteidigungsminister James Mattis ihren Hut nahmen. Zehn Monate nach Beginn der zweiten Trump-Administration ist sie zu einem zentralen Thema der US-Politik geworden, die sich immer schneller in autoritäre Richtung bewegt.
Genau darauf zielten die sechs Kongressmitglieder in ihrem 90-Sekunden-Video: Sie thematisierten die zweifelhafte Rechtmäßigkeit von Trumps Entscheidung, US-Soldaten zur Unterstützung der Einwanderungsbehörde bei der Abschiebung angeblich illegaler Migranten in die amerikanischen Innenstädte zu entsenden; oder seines Befehls, die Boote mutmaßlicher „Narco-Terroristen“ in lateinamerikanischen Gewässern zu bombardieren, ganz ohne Zustimmung des Kongresses und unter Missachtung des War Powers Act. Die Parlamentarier „rufen nicht zum Aufstand“ auf, wie das Weiße Haus behauptet, sondern bekräftigen lediglich geltendes Recht: Militär- und Geheimdienstvertreter „können und müssen illegale Befehle verweigern“.
Doch bislang haben nur wenige hohe Beamte die Rechtmäßigkeit umstrittener Trump-Befehle infrage gestellt. Und abgesehen von einem hochrangigen Militärjuristen (JAG) beim US-Southern Command in Miami, der fragte, ob die 82 Toten bei den Angriffen auf venezolanische und andere Boote als außergerichtliche Tötungen zu werten seien, schweigen die Ausführenden wie Stabschef Dan Caine bislang zu den offensichtlichen Grenzverletzungen des selbsternannten „Kriegsministers“ Peter Hegseth und des Präsidenten.
Für diese hohen Militärs und Regierungsbeamten sollte die neue Biografie über Robert McNamara, Verteidigungsminister unter den Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, zur Pflichtlektüre werden. In ihrem Buch “McNamara at War“ (2025) zeichnen die Brüder Philip und William Taubman nach, wie McNamara den Vietnamkrieg für LBJ weiter verteidigte und vorantrieb, obwohl er frühzeitig wusste, dass dieser nicht zu gewinnen war. Sie schildern ausführlich, wie „Bob“ privat zugab, dass die vom Pentagon und dem Weißen Haus um die Mitte der sechziger Jahren verbreiteten Erfolgsmeldungen reine Täuschungen waren – während junge amerikanische Soldaten weiter in den Kampf geschickt wurden.
McNamara war eines der „whiz kids“ von der Harvard Business School, die Ende der fünfziger Jahre den angeschlagenen Ford-Konzern sanierten.1960 war er zu dessen Präsidenten aufgestiegen. Wenige Jahre später holte ihn Präsident John F. Kennedy an die Spitze des Pentagon, wo er in bewährt technokratischer Manier ähnliche „Reformen“ durchsetzte. McNamara war ein Zahlenmensch, akribisch und unerbittlich – heute würde man ihn wohl einen „data guy“ nennen.
Doch er war auch überheblich. Seine Biografen zitieren einen früheren Kollegen: „Selbst wenn du wusstest, dass er falsch lag, überfuhr er dich einfach.“ Und sie beschreiben, wie McNamaras notorische Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, zu jener unbeirrbaren Loyalität gegenüber dem Präsidenten führte, die aus diesem Vertreter der „Besten und Klügsten“ letztlich eine tragische Figur der amerikanischen Geschichte machte. Später leitete er die Weltbank, wo er erneut institutionelle Reformen vorantrieb – mit gemischten Ergebnissen.
Als ich Robert McNamara Anfang der 1990er Jahre in Washington D.C. traf, begegnete mir ein Mann, der – so mein Eindruck – bemüht war, für seine früheren Fehler Buße zu tun, indem er Essays über die Gefahr eines Atomkriegs veröffentlichte. Hinter dem Mahagonitisch in seinem Büro neben dem historischen Willard Hotel saß ein gebrochener Mann, der noch immer krampfhaft nach Anerkennung suchte – diesmal als vom Kriegsstrategen zum Apostel der Abrüstung geläuterter Elder Statesman.
Erst 1995, im Alter von 78 Jahren, gestand McNamara im Vorwort seiner Memoiren „In Retrospect“ schließlich ein, dass er mit seiner Kriegstreiberei in Vietnam „falsch, furchtbar falsch“ gelegen habe. Das war mehr, als viele Kritiker und gealterte Anti-Kriegs-Aktivisten von ihm erwartet hatten. Doch in Bezug auf sein Schuldbekenntnis teilen die Biografen meine frühere Einschätzung, dass selbst McNamara’s Suche nach Vergebung selbstgerecht war, „eine rückwärtsgerichteten Kontrolle über das, was ihm entglitten war“. Niemand jedoch attackierte McNamara nach seinem Bekenntnis so heftig wie sein Mit-Sponsor des Vietnam-Kriegs Henry Kissinger: „Heul, heul”. Er schlägt immer noch reumütig an seine Brust.“
Seit dem Ende des Vietnamkriegs hat Amerika zwei weitere Kriege geführt – in Afghanistan und im Irak. Und trotz Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter, Skandalen, enormer Hybris und fahrlässiger Unkenntnis der überfallenen Länder haben nur äußerst wenige Mitglieder der US-Regierung oder hochrangige Beamte Fehler eingestanden, Schuld eingestanden oder sonstige Formen der Reue gezeigt. Es ist, als sei das völlige Abstreiten von Verantwortung und das Fehlen jeglicher Demut für die Manager des amerikanischen Imperiums zum vorherrschenden Betriebsmodus geworden.
Das Eingeständnis von Fehlurteilen oder gar von Schuld scheint mit dem politischen System der USA unvereinbar zu sein. Man denke nur an die selbstgefällige Autobiografie von Kamala Harris („107 Days“), in der sie allen anderen die Verantwortung für ihre Wahlniederlage zuschiebt, nur nicht sich selbst. Doch auch in anderen Ländern des von Krisen erschütterten Westens neigen ehemalige Führungspersonen wie Angela Merkel nicht gerade zur Selbstkritik.
Für die heutigen Ja-Sager – und einige Ja-Sagerinnen – gibt es kaum Rollenmodelle, an deren Verhalten sich die die Grenzen übertriebener Loyalität und die Vorteile ein kritischer Umgang mit Befehlen aufzeigen ließen. Was werden Männer wie General Dan Caine, der frühere Mehrheitsführer im Kongress Mitch McConnell oder Außenminister Marco Rubio tun, wenn Donald Trump einen illegalen Befehl zum Bombardement Venezuelas gibt oder eine fatal falsche Entscheidung über das Schicksal der Ukraine fällt? Wie lange werden sie sich der Illusion hingeben, dass man innerhalb des Systems Schlimmeres verhindern könne – statt offen zu widersprechen und zurückzutreten? Und wie lange wird es dauern, bis sie nach ihrem Schweigen bis zum bitteren Ende ihre Fehler eingestehen und sich mit ihrer eigenen Schuld auseinandersetzen?
Wie intelligente Menschen vom Schlage eines Robert McNamara ihr Land in eine solche Katastrophe führen können, bleibt die zentrale Frage, die seine Biografen immer wieder stellen, ohne darauf eine endgültige Antwort zu finden. Alles, was sich aus der Lebensgeschichte McNamaras ablesen lässt, ist, wie hoch der Preis blinder Loyalität sein kann. Zumindest für das eigene Land.
Vom US-Kongress bis zur BBC: Eine liberale Führungselite ohne Rückgrat
n den USA braucht es genau eine Woche, bis die siegreiche Demokratische Partei es schafft, “ihren jüngsten Wahlerfolg wieder zunichte zu machen” – so beschrieb ein Beobachter, die Kapitulation von acht Senatoren gegenüber den maßlosen Wünschen Donald Trumps. Im Vereinigten Königreich treten zwei Spitzenmanager der öffentlich-rechtlichen BBC zurück, nachdem ein Leak einen redaktionelles Missgeschehen aus dem Jahr 2024 offenlegte – während der notorische Lügner im Weißen Haus den weltweit vertrauenswürdigsten Nachrichtendienst als „schlimmer als Fake News“ beschimpft. Willkommen in der Welt einer liberalen Führungsschicht ohne Rückgrad auf beiden Seiten des Atlantiks.
In den USA braucht es genau eine Woche, bis die siegreiche Demokratische Partei es schafft, “ihren jüngsten Wahlerfolg wieder zunichte zu machen” – so beschrieb ein Beobachter, die Kapitulation von acht Senatoren gegenüber den maßlosen Wünschen Donald Trumps. Im Vereinigten Königreich treten zwei Spitzenmanager der öffentlich-rechtlichen BBC zurück, nachdem ein Leak einen redaktionelles Missgeschehen aus dem Jahr 2024 offenlegte – während der notorische Lügner im Weißen Haus den weltweit vertrauenswürdigsten Nachrichtendienst als „schlimmer als Fake News“ beschimpft. Willkommen in der Welt einer liberalen Führungsschicht ohne Rückgrad auf beiden Seiten des Atlantiks.
Was also ist innerhalb dieser turbulenten zwei Wochen geschehen? Gerade als die US-Demokraten bei wichtigen Gouverneurs-, Bürgermeister- und Kommunalwahlen am 4. November ihre ersten entscheidenden Erfolge einfuhren; gerade als die Partei zu verstehen schien, dass Wahlkämpfe nicht mit abstrakten Programmen und hohen moralischen Prinzipien gewonnen werden, sondern mit Botschaften und Botschaftern, die den lokalen Gegebenheiten entsprechen; nachdem also die zuvor hilflose Opposition scheinbar die Oberhand über Donald Trump und seine MAGA-Bewegung gewonnen hatte – verließen acht Senatoren das neu errichtete demokratische Zelt und marschierten direkt in den republikanischen Sumpf, indem sie für ein Ende des politischen Stillstandes, des Government Shutdown, stimmten.
Der Regierungsstillstand hatte am 1. Oktober begonnen, nachdem die Demokraten im Kongress die Finanzierung des neuen Haushaltsjahres blockiert hatten – aus Protest gegen geplante Kürzungen bei diversen Bundesprogrammen, insbesondere von Subventionen, die die Gesundheitskosten für Millionen Amerikaner erhöht hätten.Durch die Blockade wurden rund 800.000 Bundesangestellte in den Zwangsurlaub geschickt, was zu sozialer Not in der Mittelschicht führte und zuletzt den Flugverkehr massiv beeinträchtigte, weil Personal fehlte. Ganz zu schweigen von der Einstellung des Lebensmittelhilfeprogramms SNAP für 42 Millionen bedürftige Amerikaner am 1. November.
Laut den meisten Umfragen gaben die Bürger der regierenden Republikanischen Partei die Hauptschuld an den chaotischen Zuständen – mehr jedenfalls als den Demokraten, die die Gesetzgebung blockierten. Offenbar hatte die Öffentlichkeit genug von den rücksichtslosen und destruktiven Maßnahmen der Trump-Administration: Lebensmittelhilfen für die Armen aussetzen und gleichzeitig schmierige Partys in Mar-a-Lago feiern; Soldaten in amerikanische Innenstädte schicken und den Ostflügel des Weißen Hauses einfach ohne bauliche Genehmigung abreissen. Der Konflikt um den Shutdown war am Ende ebenso ein Streit über die Sozialpolitik der Regierung wie über die zunehmend autoritären Entscheidungen Donald Trumps.
Für die Demokraten schien sich die Stimmung also ein Jahr vor den wichtigen Kongresswahlen (midterms) zu drehen. Doch in dieses hoffnungsvolle Bild traten sieben demokratische Senatoren und ein Unabhängiger, deren politischer Horizont kaum über ihre Heimatbezirke hinausreicht, die den Kontext eines Landes auf dem Weg in die Autokratie nicht sehen wollen, die moralische Gründe für ihre Entscheidung anführen, aber den veränderten politischen Rahmen schlicht ignorieren. Acht Senatoren – fast alle jenseits des Rentenalters –, die nicht begriffen haben, dass die aktuellen Konflikte mit den politischen Kämpfen der Vergangenheit nichts mehr gemein haben.
Trump konnte daher am Mittwoch den 43-tägigen Shutdown beenden und den Sieg für sich reklamieren; die Demokraten bleiben mit nichts zurück außer dem Versprechen einer erneuten Abstimmung über Gesundheitssubventionen in zwei Wochen – die sie vermutlich verlieren werden. Eine Woche nach ihren ermutigenden Wahlerfolgen sind die Demokraten wieder zerstritten und zurück in ihren alten Gräben.
Die hilflose Kapitulation hat die Generationen in der Partei tief gespalten. Noch nie waren junge Demokraten so sehr über ihre gerontokratischen Führung verzweifelt wie nach dieser Niederlage im Kongress. In den sozialen Medien schimpften Millennials und Generation Z die Abweichler „Verräter“, „Feiglinge“, „Quislinge“ und „Arschlöcher“. Und selten war der Bruch zwischen der engagierten Basis aus Wählern bzw. lokalen Aktivisten und dem Parteiapparat so offensichtlich – für Freunde wie für Gegner. Während Demokraten außerhalb des Washingtoner Establishments ihre Empörung über die Abweichler laut äußerten, versuchte die Parteiführung, die Unterschiede wegzuerklären und das politische Debakel als taktischen Erfolg umzudeuten. Kein Wunder, dass die frisch gewählte moderate Gouverneurin von Virginia, Abigail Spanberger, die Fahnenflüchtigen verteidigte und ihre kurzfristigen taktischen Gründe lobte. Während der zukünftige, “sozialistische” New-York-Bürgermeister Zohran Mamdani deren Argumente scharf zurückwies. So viel zur kurzen Einheit unter dem demokratischen Zelt.
In diesen turbulenten Tagen wurde vor allem eines klar: Der demokratischen Führungsschicht fehlt es an der Entschlossenheit des politischen Gegners. Sie setzt weiterhin auf gewöhnliche Methoden in außergewöhnlichen Zeiten. Sie scheint nicht zu begreifen, dass sie es bei Donald Trump und seinen Gefolgsleuten nicht mit normalen politischen Widersachern, sondern mit dem Versuch einer „Konterrevolution“ zu tun haben.
Und nun nach Europa
Auch im Vereinigten Königreich lässt sich dieselbe Mutlosigkeit und Hilflosigkeit beobachten – diesmal bei den Verantwortlichen der BBC, die rechter Kritik an der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung widerstandslos nachgeben. Was ist dort passiert?
Am 3. November veröffentlichte der rechtsgerichtete Daily Telegraph ein 20-seitiges internes Memorandum des BBC-Redaktionsberaters Michael Prescott. Darin beklagte dieser, dass der Sender seine Auflistung redaktioneller Fehler, häufigen Managementversagens und einer oft unausgewogenen Berichterstattung nicht ernst genug nehme: wie den irreführenden Zusammenschnitt einer Trump-Rede in der „Panorama“-Sendung vom Oktober 2024; die „besorgniserregenden systemischen Probleme“; und seine Kritik an der Berichterstattung zu Gaza, Gender und Diversität.
Tatsächlich hatten BBC-Journalisten Trumps „fight like hell“-Rede vom Morgen des 6. Januar 2021 so zurechtgeschnitten, dass der Präsident klang, als würde er die Menge direkt zu Gewalt aufrufen – was er in dieser Form nicht tat. Dennoch war die grundsätzliche Einordnung der Sendung korrekt: Trump ermutigte seine Anhänger, gegen die Wahlergebnisse vor das Kongressgebäude zu ziehen. Und die späteren Aufständischen verstanden sehr genau, was er damit unausgesprochen meinte.
Der redaktionelle Fehler war ein Fauxpas, wie er in jeder Redaktion passieren kann – umso mehr bei einem Sender, der wöchentlich fast eine halbe Milliarde Menschen erreicht und dessen Nachrichtenbereich in den vergangenen Jahren um 30 Prozent zusammengestrichen wurde. Doch anstatt sich für den irreführenden Schnitt zu entschuldigen und selbstbewusst zur schwierigen Frage der Unparteilichkeit in Zeiten eines Dauer-Kulturkampfes Stellung zu beziehen, zauderte die BBC-Führung. Die Nachrichtenchefin hatte eine Erklärung vorbereitet, doch der Vorstand verweigerte die Freigabe. Als BBC-Vorsitzender Samir Shah nicht rechtzeitig reagierte, traten Generaldirektor Tim Davie und Nachrichtenchefin Deborah Turness zurück. Wie die acht US-Senatoren zuvor kapitulierten hier zwei Spitzenkräfte des britischen Rundfunks – und verschafften ihren rechten Kritikern einen Sieg.
Ein Blick hinter die Kulissen dieser selbstverschuldeten Krise zeigt zwei Dinge. Erstens: Wie Trumps Doppelpräsidentschaft ist auch die BBC-Krise kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger, systematischer Angriffe auf staatliche und öffentliche Einrichtungen – wennn man so will, ein 40-jähriger Marsch der Rechten durch eben diese Institutionen. Der Kampf gegen „politische Korrektheit“ und angeblich voreingenommene Berichterstattung gehört seit Jahrzehnten zum Repertoire der politischen Rechten in den USA und Großbritannien.
Was sich mit der Zeit verändert hat, ist das Medienumfeld: Lokale Konflikte werden heute mühelos auf nationale und globale Ebenen katapultiert, jede politische Auseinandersetzung wird gleich zur Kulturkrise. Und rechte Populisten wie Boris Johnson, “Reform Party”-Boss Nigel Farage und ein US-Präsident, dessen Verhalten keine moralischen, rechtlichen und nationale Schranken mehr kennt, nutzen das meisterhaft aus.
Die Akteure in der aktuellen BBC-Affäre formen eine konservative Kabale. Michael Prescott, Autor des geleakten Memos, ist Tory und Freund des Vorstandsmitglieds Sir Robby Gibb, eines von Boris Johnson eingesetzten ehemaligen spin-doctors und notorischen Kämpfers gegen „Wokeness“ bei der BBC. Zahlreiche weitere Mitglieder des Vorstands oder der Standardkommission verfolgten PR-Karrieren, nachdem sie während der 14 Jahre konservativer Regierung aus dem Journalismus ausgeschieden waren. So wurden eine ganze Reihe professioneller Journalisten in den Leitungsgremien der BBC durch politische Überläufer ersetzt, die ihre ganz eigene Definition von “Unparteilichkeit” durchsetzen wollen. Dass 80 Prozent der Experten vom menschengemachten Klimawandel überzeugt sind, spielt dabei keine Rolle – in einem „ausgewogenen“ BBC-Format sitzt dann immer ein Klima-Wissenschaftler einem Klima-Leugner gegenüber. Auch wenn die große Mehrheit veritabler Ökonomen den Brexit für eine schlechte Idee hielten – im Talkshow-Duell musste es trotzdem immer eins zu eins sein.
Zweitens: Die verbliebenen liberalen Manager und Redakteure in diesen geschwächten Institutionen bringen nicht den Mut auf, ihre angegriffenen Institutionen mit aller Kraft zu verteidigen. Statt den für den redaktionellen Fehler verantwortlichen Journalisten zu tadeln, übernahm das Management die Verantwortung: zwei Führungskräfte traten zurück, weil Boris Johnsons Zeitungskolumnen, Nigel Farage’s politisch motivierte Anschuldigungen und schließlich Trumps Drohung mit einer Milliardenklage die Situation eskalieren ließen. Statt in die Offensive zu gehen, zögerte der BBC-Vorsitzende – und der Generaldirektor, erschöpft von zu vielen „Skandalen“, gab einfach auf.
Es wäre eine interessante Frage, ob die Führung deutsche Parteien der Mitte oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit seiner föderalen und politisch komplexen Struktur besser gegen ähnliche Angriffe von rechts gewappnet wäre. Der jüngste Erfolg einer politischen Kampagne gegen eine angeblich zu “linke” Kandidatin für das BundesvVerfassungsgericht lässt dies eher bezweifeln.
Man kann die Chronologie der BBC-Krise als eine Art konservativen „Putsch“ lesen, wie es Prospect-Chefredakteur Alan Rusbridger im Observer nahelegt. Doch sinnvoller wäre es, zwischen dem ideologischen Teil von Prescotts Analyse und seinen sachlichen Auslassungen zu den strukturellen Schwächen in Bezug auf die Unabhängigkeit des Senders und sein träges, oft mutloses Management zu unterscheiden – ohne die die Affäre nie derart eskaliert wäre. Eine selbstkritische Auswertung des Memos, eine schnelle Entschuldigung für den falschen Schnitt und eine souveräne Zurückweisung der politisch motivierten Vorwürfe hätten dem öffentlich-rechtlichen Sender viel Schaden erspart. Immerhin ist der BBC-Vorsitzende mittlerweile Trumps Drohung mit einer Kompensations-Klage klar entgegen getreten.
Ob im US-Kongress oder an der BBC-Spitze – wenn die risikoscheue, ausweichende, defensiv agierende und oft feige liberale Führungsschicht nicht weiß, wie man selbsternannte „Konterrevolutionäre“ bekämpft, dann werden rechte Populisten weiter in das Vakuum der so geschwächten demokratische Institutionen vordringen. Vermutlich genau das meinte Bill Clintons früherer Arbeitsminister Robert Reich, selbst ein überzeugter Liberaler, als er über „das Verschwinden der Führungsklasse“ twitterte.
Keine Könige! Aber was für Kandiaten?
Nach einer langen, unangekündigten Sommerpause ist mein Blog „What happened to America and why“ zurück. Zwar reise ich nicht mehr durch die Vereinigten Staaten, doch werde ich weiterhin Kommentare, Buchrezensionen und Beobachtungen aus der Ferne veröffentlichen.
Ich hoffe, Sie bleiben mir treu – und empfehlen diesen Blog Ihren Freunden und Bekannten weiter. Beginnen wir dort, wo wir Anfang August aufgehört haben: bei den Demokraten – mehr als drei Monate später.
Den US-Demokraten läuft die Zeit davon. Vor einem Jahr hat die Partei zum zweiten Mal die Präsidentschaft an Donald Trump verloren. Am 4. November müssen die Demokraten nun einige wichtige Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen deutlich gewinnen, um politisch wieder Tritt zu fassen. Im November 2026 müssen sie mindestens das Repräsentantenhaus zurückerobern, um den faktischen Einparteienstaat aufzubrechen, zu dem die USA unter Donald Trump geworden sind. Und spätestens 2028 brauchen sie eine Präsidentschaftskandidatin oder einen -kandidaten, der übernehmen kann, was bis dahin noch von der amerikanischen Demokratie übrig ist. Blickt man jedoch auf den gegenwärtigen Zustand der Demokratischen Partei, würde man all das kaum vermuten.
Zwar gab es am 18. Oktober die großen „No Kings!“-Demonstrationen, bei denen zwischen vier und sieben Millionen Menschen an 2.650 Orten im ganzen Land friedlich protestierten. Doch diese Massenkundgebungen waren vor allem eine Wiederholung ähnlicher Proteste im April und Juni – eindrucksvoll, patriotisch, gut gelaunt. Oder, wie ein zynischer Beobachter meinte: „Große Anti-Trump-Demos, an denen ausschließlich Hörer von National Public Radio in demokratisch wählenden Städten teilnehmen, beeindrucken kaum Wähler auf dem Land.“ Tatsächlich zeigten sich auf den Protestzügen kaum neue Gesichter – keine Reumütigen unter früheren Trump-Wählern, keine Rückkehrer aus der politischen Apathie. Die Demonstrationen stärkten vor allem Anhänger im eigenen Lager. Doch jene Wählerinnen und Wähler, die die Demokraten dringend brauchen, um wieder Boden zu gewinnen, müssen erst noch überzeugt werden, für die Opposition zu stimmen.
Nur warum, nach all den dramatischen, gefährlichen, skandalösen, schädlichen, illegalen, rachsüchtigen, gemeinen und demokratiefeindlichen Aktionen, die die Trump-Administration im vergangenen Jahr entfesselt hat, ist das so? Weil die Demokratische Partei noch immer im Schockzustand verharrt – und wenig Anzeichen zeigt, sich neu zu erfinden. Doch es gibt zumindest erste Lebenszeichen: Zwei vielversprechende Kandidatinnen treten in New Jersey und Virginia für das Gouverneursamt an, und mit Zohran Mamdani mischt in New York ein junger Aufsteiger das Bürgermeisterrennen auf.
Abigail Spanberger in Virginia und Mikie Sherrill in New Jersey sitzen seit 2018 im Repräsentantenhaus, wo sie sich als moderate Stimmen etabliert haben. Beide bringen sicherheitspolitische Erfahrung mit – Spanberger als frühere CIA-Offizierin, Sherrill als Hubschrauberpilotin der Marine. Die Financial Times nennt sie „kämpferische Zentristinnen“. Begriffe wie „defund the police“ oder „democratic socialism“ kommen ihnen nicht über die Lippen. Gemeinsam mit zwei weiteren Abgeordneten bilden sie das sogenannte „mod squad“ – als moderates Gegenstück zum bekannten „Squad“ der vier progressiven Kongressabgeordneten, die auf nahezu allen linken Themenfeldern aktiv sind, von LGBTQ bis Gaza.
Doch wenn Spanberger und Sherrill in Bürgerversammlungen gefragt werden, ob Transgender-Mädchen im Frauensport antreten sollten, geraten sie ins Stocken. Sie wollen niemanden vor den Kopf stoßen – und schon gar keinen Shitstorm vom linken Flügel ihrer Partei riskieren. Dennoch: Durch Elon Musks DOGE-Operation, in deren Rahmen zahlreiche Bundesangestellte in Virginia entlassen wurden, und nach Donald Trumps Entscheidung, ein Pendler-Tunnelprojekt in New Jersey zu stoppen, stehen ihre Wahlchancen nicht schlecht.
Und dann ist da noch Zohran Mamdani, 34 Jahre alt, in Uganda geboren, muslimisch, Sohn prominenter ugandisch-indischer Eltern – und der Shootingstar der New Yorker Demokraten. Aus dem Nichts gewann er die Vorwahlen gegen zwei kompromittierte Parteifreunde. Der Abgeordnete aus Queens verkörpert alles, was die Demokraten bei der letzten Wahl nicht bieten konnten: Er begeistert junge und neue Wähler, kommuniziert authentisch, wirkt dynamisch, risikofreudig, optimistisch – und spricht Themen an, die Menschen in seiner teuren Stadt unmittelbar betreffen: Mieten und Kinderbetreuung, die sich die Leute nicht mehr leisten können.
Mamdani bezeichnet sich offen als „demokratischen Sozialisten“. Er fordert einen Mietpreisstopp, kostenlose Kinderbetreuung, Gratis-Busse, Steuererhöhungen für Reiche und städtische Lebensmittelmärkte für Arme. Und er wagt es, sich in einer Stadt, die zu zwölf Prozent muslimisch und zu zwanzig Prozent jüdisch ist, offen für die Palästinenser einzusetzen. Seine TikTok-Videos, in denen er Menschen aus allen Milieus auf der Straße trifft, sind längst legendär. Selbst demokratische Parteistrategen loben seine Kampagne als vorbildlich; seine Gegner erkennen neidisch ihre Wirkung an.
Mit fast zehn Prozent Vorsprung in den Umfragen dürfte der charismatische und unermüdliche Mamdani bald Bürgermeister der größten US-Stadt werden – mit fast 300.000 Beschäftigten und einem Haushalt von 115 Milliarden Dollar. Und das ganz ohne Verwaltungserfahrung. Er ist der Liebling der progressiven Demokraten, die seinen Sieg als Beweis dafür ansehen, dass sich die Partei nach links bewegen muss, will sie Erfolg haben. Für Donald Trump und die Republikaner bietet Mamdani dagegen ein willkommenes Feindbild – als „100 Prozent kommunistischer Spinner“, wie Trump ihn nannte.
Die Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen am 4. November werden den Enthusiasmus in der MAGA-Wählerschaft testen: derer die 2016 und 2024 erstmalig gewählt haben und derer, die von den Demokraten einfach nur enttäuscht waren. Aber sie sind vor allem ein Test für die Demokratische brand oder Marke. Entscheidend wird sein, wie die Partei die Ergebnisse interpretiert. Denn angesichts der Führungsschwäche droht sie, in alte Grabenkämpfe zurückzufallen: zwischen jenen, die auf Kandidaten mit moderaten Positionen zu Einwanderung, Sicherheit und Abtreibung setzen, und jenen, die progressive Repräsentanten mit einer linken Sozial-und Wirtschaftspolitik bevorzugen. Als könne nur einer dieser Wege zum Erfolg führen.
Doch bisher waren weder strategische Planung noch professionelle Kandidatenförderung der Grund für die jüngsten Lichtblicke. Im Gegenteil: Mamdanis Kandidatur wurde von der überalterten Parteielite anfangs mit allen Mitteln bekämpft – einem Establishment, das von Milliardären, Lobbyisten und einer Armee selbstverliebter Berater geprägt ist und mit den Wählern von oben herab über veraltete Medienkanäle kommuniziert.
Noch immer wird das Bild der Partei von den Clintons und Obamas geprägt – und von einer Kongressführung, deren risikoscheue Kultur und austauschbare Talking Points in der von Donald Trump vorbildlich gepflegten Aufmerksamkeitsökonomie völlig fehl am Platz sind. Und dann ist da noch die Verliererin Kamala Harris, deren selbstgerechte Memoiren sowie ihr Ausloten einer erneuten Präsidentschaftskandidatur 2028 der Partei mehr schaden als jeder republikanische Angriff. Mit solchen Führungspersonen braucht man keine politischen Gegner mehr.
Die gegenwärtig Führung der Demokraten mit ihren Figuren aus der Vergangenheit hat immer noch nicht verstanden, wie tief die Partei gefallen ist, Donald Trump hin oder her. Die Erosion der Demokratischen Partei begann schon in den 1980er-Jahren, als sie damit begann, ebenso großzügig Spenden von Konzernlobbys anzunehmen wie die Republikaner. In den 1990ern folgten die an der Wahlurne erfolgreichen, aber wirtschaftlichen folgenreichen Clinton-Jahre – Freihandel, Globalisierung, der Verlust von Industriearbeitsplätzen. Dann kam die Finanzkrise 2008. Seither hat sich die soziale Basis beider Parteien verschoben: Heute wählen wohlhabendere Amerikaner mit überdurchschnittlichem Einkommen eher demokratisch. Selbst ein Linker wie Zohran Mamdani bekam in den Vorwahlen mehr Stimmen von reichen als von armen New Yorkern.
Die Republikaner vertreten dagegen inzwischen mehr Wahlkreise, in denen die untere Mittelschicht dominiert, als die Democrats. „Wenn die Demokraten diesen Kurs nicht umkehren“, schreibt der Journalist Brody Mullins in der New York Times, „werden sie bald keine Präsidentschaftswahlen mehr gewinnen können.“ Grund dafür ist das Wahlmänner-System, das ländlichen Regionen mit konservativen Wählern mehr Gewicht verleiht, während sich die wohlhabenderen Wähler der Demokraten in den urbanen Wahlbezirken entlang der Küsten konzentrieren.
Laut einer Gallup-Umfrage vom Juli liegt die Beliebtheit der Demokraten bei nur 34 Prozent – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebungen 1992. 60 Prozent äußern eine negative Meinung über die Partei, und zwar quer durch alle Alters-, Einkommens- und Bevölkerungsgruppen. Bei Themen wie Wirtschaft, Einwanderung und Kriminalität schneiden die Republikaner deutlich besser ab.
Der Forscher Jared Abbot nennt das den „zweistelligen Demokraten-Malus“: damit meint er den von ihm bemessenen Abstand zwischen den realen Inhalten ihrer Politik und dem negativen Image, das mit der Partei verbunden ist. Vor allem in der Arbeiterschaft des Rostgürtels ist das Image der Partei um rund 10 % schlechter als die Haltung der Wähler zu einzelnen Programmpunkten. Abbot meint damit die Leute, die mir auf meiner Reise immer wieder sagten, sie würden nie mehr für die Demokraten stimmen – egal, was komme.
Wie also könnte die Partei ihr Image ändern – und auf mögliche Erfolge in Virginia, New Jersey und New York aufbauen? Indem die verschiedenen Fraktionen einen Wahlsieg nicht für sich reklamieren, sondern sorgfältig analysieren, warum welche Kandidat(inn)en wo gewonnen haben. Aus Mamdanis besonderer Situation in New York wird sich wenig auf andere Wahlkämpfe übertragen lassen – aber seine meisterhafte Medienstrategie wäre eine Lektion wert.
Adam Jentleson vom neuen Thinktank „Searchlight Institute“ fordert mehr „Heterodoxie“ – mehr Kandidatinnen und Kandidaten, die als politisch unabhängig auftreten und nicht wie Vertreter des demokratischen Apparats. Und wer dabei etwas konservativer klingt, sollte nicht sofort als Verräter abgestempelt werden. Denn nicht alle Republikaner sind Rassisten oder religiöse Fundamentalisten. Viele lehnen zwar Bidens in der Tat fahrlässige Grenzpolitik ab, aber ebenso den Einsatz von Soldaten gegen Migranten in den Städten. Die meisten Langzeit-Umfragen zeigen: Auch republikanische Wähler haben sich über die Jahre in vielen Fragen nach links bewegt – nur eben langsamer als Demokraten. Das Land ist weniger polarisiert, als es scheint.
Für die Demokraten bedeutet das: Authentizität statt Ausweichmanöver. Spanberger und Sherrill sollten sagen können, was sie wirklich über Transgender-Sport denken – statt herumzudrucksen. Das heißt nicht zwingend, dass die Demokraten in konservativen Bezirken jetzt „Pro-Life“-Kandidaten aufstellen sollten. „Trumps Genie besteht darin, die Demokraten in reaktiven Konservatismus zu treiben“, schreibt der Financial Times-Kolumnist Ed Luce. Das Genie der Demokraten müsste darin liegen, ihre Reaktion in etwas Neues und Eigenes zu verwandeln.
Eine funktionierende Parteiführung könnte Orientierung geben, wo die Grenze zwischen politischer Zweckmäßigkeit und moralischer Haltung verläuft. Weniger Ideologie, mehr Pragmatismus – das wäre ein guter Anfang. Denn es kann nicht sein, dass während Donald Trump die Demokratie zerlegt, demokratische Kandidaten Angst haben, pragmatisch, authentisch und streitbar zu sein. Der Late Night Comedian Jon Stewart hat Trumps Erfolg auf den Punkt gebracht: Donald Trump könne “die Stimmung im Raum lesen”. Genau das müssen die Demokraten erst noch lernen – die Stimmung im Raum ihres jeweiligen Wahlbezirks lesen, d.h. die politischen Wirklichkeit wahrzunehmen.
Der fundamentale Denkfehler der Demokraten liegt in der Annahme begründet, es gäbe noch „normale“ politische Spielregeln. Dass man gegen Trump gewinnen könne, ohne eine eigene Erzählung, eine eigene Vision. Die letzten zehn Jahre zeigen das Gegenteil. Die neue Aufmerksamkeitsökonomie, alternative Medien, ökonomische Umbrüche, die neue Klassenstruktur, die Wahlgeografie und die anachronistische Verfassung stehen zunehmend einem “normalen” Machtwechsel im Weg.
Die alte politische Ordnung ist verschwunden, und die „Grand Old Party“ ist über die letzten vierzig Jahren zur MAGA-Bewegung mutiert, die sich nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln bekämpfen lässt. Selbst konservative Intellektuelle wie Bill Kristol oder David Brooks haben dies erkannt – ersterer unterstützt offen den demokratischen Sozialisten Zohran Mamdani, letzterer schreibt, Amerika brauche eine „Massenbewegung“ und „Gegenkultur“ gegen MAGA. Doch die Demokraten agieren weiter, als wäre das System intakt. Dabei müssten sie seine Reste verteidigen, ohne als Teil des Systems oder des “Establishments” zu erscheinen. Zugegeben, ein schwieriges Unterfangen.
Wer hofft, die Demokratische Partei könne im kommenden Jahr allein mit sorgfältig geprüften Bewerbern in die Zwischenwahlen gewinnen, ist naiv. Und mit Kandidaten aus dem kalifornischen Establishment wie Kamala Harris oder Gary Newsom 2028 in den Präsidentschaftswahl zu ziehen, wäre Selbstmord für eine Partei, die sich bis heute weigert, die neuen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Realitäten anzuerkennen.
Der 5. November 2025 könnte da ein Anfang sein, WENN…
Politisch tot oder noch lebendig? Was können die Demokraten tun?
Selbst nach sechs Monaten in der zweiten Amtszeit von Donald Trump zeigen die meisten Umfragen, dass der Rückgang seiner Beliebtheitswerte nicht in Unterstützung für die Demokratische Partei umschlägt. Das stimmt mit dem überein, was mir während meiner Reisen durch das ländliche Amerika im Frühjahr republikanische Wähler erzählt haben. Sie konnten sich vorstellen, in ein paar Jahren von Donald Trump enttäuscht zu werden – und vielleicht sind einige es jetzt schon. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, in absehbarer Zukunft für die Demokraten zu stimmen: „nicht für diese “woke” Partei, die nichts anderes getan hat, als Geld an andere zu verteilen, nur nicht an uns“. Es gibt viele und zum Teil widersprüchliche Erklärungen dafür, warum die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 verloren haben. Und die Partei diskutiert seitdem ihre zahlreichen Fehler. Aber es gibt keine überzeugende Erklärung für das tief empfundene Misstrauen und diese heftige Abneigung gegen die Demokraten, sogar bei moderaten Republikanern und unabhängigen Wählern.
Selbst nach sechs Monaten in der zweiten Amtszeit von Donald Trump zeigen die meisten Umfragen, dass der Rückgang seiner Beliebtheitswerte nicht in Unterstützung für die Demokratische Partei umschlägt. Das stimmt mit dem überein, was mir während meiner Reisen durch das ländliche Amerika im Frühjahr republikanische Wähler erzählt haben. Sie konnten sich vorstellen, in ein paar Jahren von Donald Trump enttäuscht zu werden – und vielleicht sind einige es jetzt schon. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, in absehbarer Zukunft für die Demokraten zu stimmen: „nicht für diese “woke” Partei, die nichts anderes getan hat, als Geld an andere zu verteilen, nur nicht an uns“. Es gibt viele und zum Teil widersprüchliche Erklärungen dafür, warum die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 verloren haben. Und die Partei diskutiert seitdem ihre zahlreichen Fehler. Aber es gibt keine überzeugende Erklärung für das tief empfundene Misstrauen und diese heftige Abneigung gegen die Demokraten, sogar bei moderaten Republikanern und unabhängigen Wählern.
Zunächst gab es eine Debatte, ob die Niederlage von Kamala Harris auf den späten Ausstieg von Präsident Joe Biden aus dem Rennen und das Missmanagement ihrer verspäteten Wahlkampagne zurückzuführen sei, oder auf einen strukturellen „vibe shift“ in der amerikanischen Politik. Heute können wir sagen, dass wohl beides der Fall war. Mit einem um 20 Jahre jüngeren Joe Biden oder einem anderen Kandidaten gleich von Beginn an des Wahlkampfs hätten die Demokraten gewinnen können. Aber gleichzeitig verändern sich die Grundlagen der amerikanischen Politik schon seit einiger Zeit, und die meisten dieser Veränderungen sind zum Nachteil der Demokratischen Partei.
Ja, die Demokraten hätten 2024 gewinnen können, wenn Kamala Harris sich stärker von Bidens Politik, insbesondere im Bezug auf Gaza, distanziert hätte. In diesem Fall hätten sie mehr Stimmen von jungen und arabisch-amerikanischen Wählern bekommen. Die Demokraten haben es auch versäumt, sich als Anti-Kriegs-Partei zu positionieren, statt diese Rolle Donald Trump zu überlassen. Sie hätten gewinnen können, wenn sie nicht eine Kandidatin aufgestellt hätten, die schon für das Vizepräsidentenamt nur zweite Wahl war, dazu noch aus Kalifornien, die dachte, sie könne es mit Unterstützung von Beyoncé und Taylor Swift schaffen. Sie hätten gewinnen können, wenn sie sich mehr um die afroamerikanischen und hispanischen Wähler und Wählerinnen gekümmert hätten. Und sie hätten gesiegt, wenn sie ihre Wirtschaftspolitik besser erklärt und das Inflationsproblem frühzeitig angegangen wären.
Aber das ist Schnee von gestern. Was die Demokratische Partei jetzt angehen muss, sind die strukturellen Verschiebungen, die das Ergebnis zukünftiger Wahlen beeinflussen und rechts-populistische Kandidatendidaten begünstigen werden – das, was einige Beobachter „das Ende der alten Politik“ nennen. Denn die Demokraten hinken mit ihrem Verständnis des neuen politischen Umfelds und ihren Versuchen, sich dem anzupassen, weit hinterher.
Wenn man sich die Demokratische Partei heute ansieht, streitet sie immer noch über die Niederlage von 2024, anstatt sich auf die Zwischenwahlen im November 2026 vorzubereiten. Ihre Struktur und Finanzierung werden immer noch von Eliten geprägt, ihre internen Gremien scheinen unvorbereitet, viele ihrer Vertreter sind wenig inspirierend, ihre Kongressführung wirkt hilflos und verloren. Und die Energie hinter den großen Demonstrationen im April und Juni kam aus der Zivilgesellschaft, nicht aus der Demokratischen Partei selbst.
Nach der Niederlage hat sich der Generationenkonflikt verschärft, zwischen jüngeren Wählern, die denken, die Partei müsse nach links rücken, und älteren Demokraten, die glauben, dass weniger Identitätspolitik und mehr “Bidenismus” mit einem anderen Kandidaten ausreichen werden. Doch arbeiten derzeit nur wenige Demokraten an einer neuen Erzählung, die Elemente beider Strömungen zu einer positiven Vision vereint, damit die Wähler wissen, wofür die Partei eigentlich steht. Und noch fehlt es den “Democrats” an risikobereiten Beratern, die diese neue Identität in einen über alle Medienkanäle kommunizierten Wahlkampf übersetzen.
Über die Jahre haben die Demokraten „die Arbeiterklasse verloren“, wie es heißt. Sie haben nicht auf die Ergebnisse der Finanzkrise von 2008 reagiert, als Präsident Obama die Banker rettete und die middle class mit ihren Hypotheken und Rentenplänen im Stich ließ. Sie haben die Beschwerden der Bürger über die Kosten der fragwürdigen Kriege in Afghanistan und im Irak ignoriert, während diese zu Hause die Gürtel enger schnallen mussten. Sie spürten nicht, dass sich das Spielfeld verschob, als eine radikalisierte Republikanische Partei den traditionellen politischen Wettbewerb in einen Kulturkrieg verwandelte: von den ersten Angriffen auf politische Korrektheit in den 90er Jahren, über die 2008 von der Tea Party ausgedrückte Wutkampagne, bis hin zu dem Hass, der 2015 von der MAGA-Bewegung geschürt und von Donald Trump gefördert wurde. Sie nahmen nicht wahr, in welchem Ausmaß sie selbst als Partei der gebildeten kulturellen Eliten angesehen wurden, die den Kontakt zu den gewöhnlichen Wählern, insbesondere zu jungen Männern ohne Hochschulabschluss, verloren hatten. Und schließlich verstanden sie nicht, wie sehr die “Aufmerksamkeitsökonomie” einer veränderten Medienlandschaft sie im Vergleich zu einer politischen Rechten benachteiligte, die systematisch ihren alternativen Mediensektor mit Talkshow-Jocks aus der Manosphere und Influencern aufgebaut hatte, angeführt von einem Präsidenten, dessen permanente Prahlereien und Lügen Amerika in eine „No-Truth“-Gesellschaft verwandelten.
Rund 450 Tage vor den Zwischenwahlen, bis zu denen die Partei ihre Identitätskrise bewältigen muss, mangelt es nicht an Ratschlägen von Politikern und Meinungsforschern. Ex-Präsident Obama, der nicht gerade für politischen Mut bekannt ist, hat seine Partei dafür kritisiert, sich nicht genug gegen Trump zu wehren und fordert sie jetzt auf, „sich zusammenzureißen“. Das Democratic National Committee verspricht, den seine Sprache in den sozialen Medien von sorgfältig vorformuliertem und in Umfragen getestetem Formulierungen um vulgäre Ausdrücke wie „sh...“ und „f...“ zu erweitern, um mehr „Authentizität“ zu zeigen. Und Antonio Delgado, der Vizegouverneur von New York, fordert die Landes- und Kommunalregierungen auf, die von Republikener durchgesetzten Kürzungen des sozialen Sicherheitsnetzes durch höhere lokale Steuern für Reiche auszugleichen.
Der überraschende Erfolg von Zohran Mamdani bei der kürzlichen demokratischen Vorwahl für das Bürgermeisteramt in New York mit seiner energischen, originellen und mediengetriebenen Kampagne ist wohl der meist analysierte Sieg in der jüngeren Wahlgeschichte der Demokraten. Der 33-jährige, freundliche, sprachgewandte, in Uganda geborene Abgeordnete des Bundesstaates New York indischer Abstammung hatte die favorisierten Kandidaten des demokratischen Establishments klar geschlagen, indem er das Thema „Bezahlbarkeit“ direkt an den Wähler brachte. Er durchquerte die Stadtviertel und dokumentierte seine Diskussionen mit New Yorkern aus allen Bevölkerungsschichten an Kebab-Ständen und Straßenecken auf TikTok und Instagram. Daraufhin haben junge Wähler mit großer Mehrheit für ihn gestimmt.
Mit guten Chancen, im November Bürgermeister des traditionsgemäß demokratischen New York zu werden, ist Mamdani nun das Aushängeschild für progressive Parteigänger, die glauben, dass seine linksgerichteten Politvorschläge und seine Medienstrategie der Weg nach vorn sind. Als im Ausland geborener muslimischer “Sozialist” ist er aber auch die ideale Hassfigur für die Republikaner. Was auch immer man von seinen politischen Vorschlägen und der Anwendbarkeit seiner Kampagnen-Techniken bei Kongress- oder Präsidentschaftswahlen hält, Mamdani ist der erste Demokrat, der seiner Partei gezeigt hat, wie man im neuen Medienumfeld einen erfolgreichen Wahlkampf führt.
Was können die Demokraten also tun, um das tief verwurzelte Misstrauen, das sich im Laufe der Jahre gegen sie aufgebaut hat, zu überwinden? Wenn man dem Kolumnisten Thomas B. Edsall folgt, der seit Jahrzehnten Wahlergebnisse und Expertenrat für die New York Times interpretiert und einen grundlegenden Wandel in der politischen Landschaft vom „Gruppendenken“ zu den „Bedürfnissen und Beschwerden einzelner“ beobachtet, sollten die Demokraten nicht auf einen automatischen Machtwechsel, auf den traditionellen anti-incumbency-effect hoffen. Nachdem sie die Stimmen der Gewerkschafter verloren haben, während die Republikaner das Votum der Kirchen gewonnen haben, müssten sie ihre Reichweite vergrößern. Sie sollten sich von politischer Korrektheit und kulturellem Liberalismus distanzieren und eine größere ideologische Vielfalt tolerieren. Sie sollten keine Kandidaten mehr aufstellen, die zwar den liberalen Lackmus-Test der Parteiaktivisten bestehen, aber dann die konkreten Erwartungen eines breiteren Publikums nicht erfüllen.
Es gibt eine Reihe von Beispielen, bei denen demokratische Politiker in Bundesstaaten und Wahlkreisen erfolgreich waren, die im Herbst 2024 von Donald Trump gewonnen wurden. Es gibt Demokraten wie den früheren Verkehrsminister Pete Butigieg, der es schafft, in konservativen Talkshows und Influencer-Kreisen zu bestehen; oder wie Senatorin Elissa Slotkin (Michigan), die Wähler erfolgreich in einfacher Sprache anspricht; oder wie Senator Chris Murphy (Connecticut), der mit seinen Aussagen zur Wirtschaft wie ein progressiver Populist klingt. Aber insgesamt wird das Bild der Partei noch immer von denen geprägt, die einfach nicht vom demokratischen Podium abtreten wollen: den Bidens, den Clintons, den Pelosis und Obamas – und von Kamala Harris, die letzte Woche nicht ausgeschlossen hat, 2028 erneut zu kandidieren.
Doch es bleibt wenig Zeit, die alte Garde loszuwerden und eine neue Generation hoffnungsvoller Außenseiter in der Partei zu fördern, bevor die entscheidenden Zwischenwahlen Ende 2026 stattfinden. Mindestens eine Kammer des US-Kongresses zurückzugewinnen, wird keine leichte Aufgabe. Es ist unwahrscheinlich, dass die Demokraten die erforderlichen vier Sitze im Senat hinzugewinnen. Im Repräsentantenhaus, wo etwa 20 Kongresswahlkreise offen sind und die aktuelle republikanische Mehrheit bei 219 zu 212 Sitzen liegt, haben sie dagegen bessere Chancen.
Doch es gibt erhebliche Hindernisse. Beim Sammeln von Wahlkampfspenden für die Kongress und Bundesstaatswahlen, liegen die Demokraten bereits weit hinter den Republikanern zurück. In Bundesstaaten wie Texas versucht die Grand Old Party derweil mit ihrer Mehrheit im Lokalparlament, durch Änderung der Wahlbezirksgrenzen mehr sichere Sitze für die Republikaner zu schaffen.
Und die nationale Bevölkerungswanderung von “blauen” Bundesstaaten wie Kalifornien, zu von den Republikanern beherrschten “roten” Bundesstaaten wie Florida und Texas, benachteiligt die Demokraten zusätzlich; ganz zu schweigen vom drohenden Zusammenbruch der Demokratischen Wählerschaft in ländlichen Bundesstaaten. Kurzum, auch die längerfristigen Veränderungen sprechen nicht für die Demokraten.
Umso wichtiger wird es für die Demokratische Partei, die Auswahl der Kandidaten zu verbessern und Wahlkampagnen zu entwickeln, die weniger ideologisch und pragmatischer sind – weniger von allgemeinen Politikvorschlägen geprägt, dafür aber maßgeschneidert auf den jeweiligen Bundesstaat oder Wahlkreis, um eine breitere Wählerschaft als nur die demokratische Basis anzusprechen. Und diese Kampagnen müssen auf allen sozialen Medienkanälen geführt werden, wo nicht nur das Medium die Message ist, sondern beides auch noch zum Kandidaten passen muss. Keine leichte Aufgabe.
Doch um der zunehmend radikalen Agenda der Republikaner ein Veto entgegensetzen zu können, wird eine demokratische Mehrheit zumindest im Repräsentantenhaus entscheidend sein. Denn mit einer unterwürfigen Republikanischen Partei, einem Supreme Court, der klar auf der Seite von Donald Trump steht, Wirtschaftseliten, die ihre Eigeninteressen verfolgen, und Rechtskonservativen, die in den Medien den Kampf um die Aufmerksamkeit gewinnen, könnte die Trump-Administration in den verbleibenden zwei Jahren ihrer Amtszeit – sofern es bei zwei Jahren bleibt – ohne jegliche Kontrolle oder Gegenmacht agieren. „Uns gehen die Schutzwälle aus”, wie es der Kolumnist der New York Times, Frank Bruni, ausdrückt. Sollten die Demokraten auch 2026 wieder scheitern, wird es kaum noch Widerstand gegen den weiteren Abbau der amerikanischen Demokratie geben.
Kulturkampf im Verfassungsgericht
Zu einer Zeit, in der die Politisierung der Justiz Deutschland erreicht hat, könnte es sinnvoll sein, einen Blick auf die Vereinigten Staaten zu werfen, um zu sehen, wohin dies führen kann. Natürlich unterscheiden sich die Justizsysteme auf beiden Seiten des Atlantiks erheblich, aber die jüngsten Entwicklungen zeigen gewisse Ähnlichkeiten aufgrund der Art und Weise, wie soziale Medien den politischen Diskurs prägen. Die algorithmische Logik der Medienplattformen ermöglicht es gut organisierten rechten Minderheiten, Themen wie Abtreibung zu nutzen, um die Auswahl von Richtern und Gerichtsurteile zu beeinflussen. Ohne sein Wahlversprechen an evangelikale und konservative Wähler, den Obersten Gerichtshof mit „Pro-Life“-Richtern zu besetzen, wäre Donald Trump 2016 nicht Präsident geworden; und ohne die konservativen Richter und Richterinnen, die er seitdem ernannt hat, wäre das aktuelle Abdriften des Landes in eine Autokratie nicht möglich.
Zu einer Zeit, in der die Politisierung der Justiz Deutschland erreicht hat, könnte es sinnvoll sein, einen Blick auf die Vereinigten Staaten zu werfen, um zu sehen, wohin dies führen kann. Natürlich unterscheiden sich die Justizsysteme auf beiden Seiten des Atlantiks erheblich, aber die jüngsten Entwicklungen zeigen gewisse Ähnlichkeiten aufgrund der Art und Weise, wie soziale Medien den politischen Diskurs prägen. Die algorithmische Logik der Medienplattformen ermöglicht es gut organisierten rechten Minderheiten, Themen wie Abtreibung zu nutzen, um die Auswahl von Richtern und Gerichtsurteile zu beeinflussen. Ohne sein Wahlversprechen an evangelikale und konservative Wähler, den Obersten Gerichtshof mit „Pro-Life“-Richtern zu besetzen, wäre Donald Trump 2016 nicht Präsident geworden; und ohne die konservativen Richter und Richterinnen, die er seitdem ernannt hat, wäre das aktuelle Abdriften des Landes in eine Autokratie nicht möglich.
Wenn wir auf die Geschichte des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten (SCOTUS) zurückblicken, gab es immer politische Auseinandersetzungen über seine Auslegung der Verfassung. Als das Verfassungsgericht mit seinen Urteilen in den 30er Jahren ein Teil der der New Deal-Gesetzgebung von Franklin D. Roosevelt blockierte, drohte der Präsident damit, die Zahl der Richter zu erhöhen, um seine politische Agenda durchzusetzen. Später ignorierte das Gericht jahrelang die offensichtliche Verletzung der Verfassung durch die fortgesetzte Rassentrennung in den Südstaaten, bevor es zwischen Ende der 50er und Ende der 60er Jahre dazu gedrängt wurde, politische Reformen durch die Bürgerrechtsgesetze zu unterstützen.
Dabei haben sich zwei traditionelle Muster herausgebildet. Erstens führt die Ernennung der Richter auf Lebenszeit zu einer zeitlichen Verzögerung, so dass die liberale oder konservative Rechtsprechung noch lange nach einem möglichen Politikwechsel fortbesteht. Und zweitens reagiert das Gericht oft verspätet und zögerlich auf Veränderungen, die von der Zivilgesellschaft, d.h. von einfachen Leuten, die vor den unteren Gerichten für ihre Rechte kämpfen, und von liberalen Anwälten, die staatliche Behörden wegen der Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte von Bürgern verklagen, angestoßen werden.
Nachdem in der Nachkriegszeit die Demokraten konservative und die Republikaner liberale Richter ernannt hatten und der Oberste Richter Earl Warren, selbst ein Republikaner, eine Reihe historisch fortschrittlicher Entscheidungen getroffen hatte, begann in den 1980er Jahren unter Ronald Reagan die Polarisierung der Justiz. Mit dieser neuen Riege republikanischer Richter wurde der „Originalismus“ - die richterliche Theorie, dass der Verfassungstext so gelesen werden muss, wie die weißen Männer von 1788 ihn verstanden und ratifiziert haben - vom Gericht als Instrument zur Durchsetzung konservativer Orthodoxien eingesetzt. Die Aufhebung der Wahlrechtsgesetze (2013) und der Umweltgesetze (2022) waren nur einige der umstrittenen Urteile in diesem langfristigen konservativen Wandel des Gerichts.
Das entscheidende Ereignis, das die Übernahme des Obersten Gerichtshofs der USA durch rechte Ideologen ermöglichte, war jedoch politischer Natur. Nach dem Tod des erz-“originalistischen” Richters Antonin Scalia im Februar 2016 versprach der republikanische Führer im US-Senat, Mitch McConnell, jede Nachbesetzung durch die demokratische Regierung zu blockieren, „bis wir einen neuen Präsidenten haben“ - und koppelte damit das Ernennungsverfahren an die neun Monate später stattfindende Präsidentschaftswahl.
Diese beispiellose und populistische Entscheidung der Republikaner im US-Kongress vermischte Verfassungsrecht und Politik. Sie sorgte dafür, dass Donald Trump bei Evangelikalen und Konservativen mit dem Versprechen werben konnte, Richter zu ernennen, die das historische Roe-versus-Wade-Urteil von 1973, das amerikanischen Frauen das Recht auf freie Wahl zusprach, aufheben würden. Er tat dies, indem er eine Liste mit „Pro-Life“-Richtern veröffentlichte, die er für freie Stellen am Obersten Gerichtshof in Betracht ziehen würde; und gewann damit seine erste Präsidentschaft, weil 80 % der evangelikalen Christen für ihn stimmten.
Danach hat Donald Trump die Politisierung des Obersten Gerichtshofs gezielt weiter betrieben. Als Präsident ernannte er zunächst zwei sozial konservative, männliche Richter. Und als die liberale Ikone des Gerichts, Ruth Bader Ginsburg, starb, brachte er die Ernennung von Amy Coney Barrett nur fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl von 2020 durch den republikanisch kontrollierten Kongress durch. Von „Mitsprache des amerikanischen Volkes bei der Auswahl (der Richterin, R.P.)“, wie die Republikaner vier Jahre zuvor argumentiert hatten, war diesmal keine Rede mehr.
Die versprochene Aufhebung von Roe v. Wade erfolgte am 24. Juni 2022, als der Oberste Gerichtshof mit dem Dobbs-Urteil entschied, dass die Verfassung kein Recht auf Abtreibung gewährt, und damit die Befugnis, Gesetze zur Abtreibung zu erlassen, an die Bundesstaaten zurückgab. Das Versprechen der Demokratischen Partei, das Recht der Frauen auf Abtreibung wiederherzustellen, trug danach dazu bei, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen im selben Jahr mehr Stimmen erhielten als erwartet. Aber es hat den Demokraten nicht geholfen, eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump im November 2024 zu verhindern.
Heute sind die Ergebnisse einer langfristigen Politisierung der Justiz, die zu einem mit Ideologen und Jasagern gespickten Obersten Gerichtshof geführt hat, deutlich sichtbar. Mit seiner konservativen 6:3-Mehrheit hat das Verfassungsgericht den Frauen das Recht auf ihren Körper genommen, aber dem vermutlichen Straftäter im Weißen Haus fast völlige Immunität gewährt; es schränkt jetzt die Rechte von Migranten und ihren Familien ein, gibt aber dem „verrückten König“ als Präsident neue Befugnisse. Es setzt die Rechte des Volkes außer Kraft und duldet die Umgehung des Kongresses durch die Exekutive.
Damit der Oberste Gerichtshof der USA seine Aufgabe erfüllen kann, die Bürger vor Übergriffen der Regierung zu schützen, sind zwei Dinge erforderlich: eine Exekutive, die an ein faires Verfahren zur Ernennung von Richtern gebunden ist, und ein Senat, der sich zu deren Bestätigung verpflichtet. Beide Voraussetzungen für eine funktionierende Gewaltenteilung sind in den letzten zehn Jahren aufgegeben worden. Infolgedessen verlieren die amerikanischen Bürger Umfragen zufolge das Vertrauen in die einst hochgeschätzte Institution des Landes.
In der Vergangenheit suchten die Richter des Obersten Gerichtshofs selbst bei der Abfassung kontroverser Stellungnahmen noch nach einem Grundkonsens. Diese Praxis ist mit den Trump-Jahren verschwunden. Und kürzlich hat die Politisierung sogar das Innenleben des Gerichts erreicht. Nachdem der Oberste Gerichtshof Trump unlängst weiten Spielraum bei der Umsetzung seiner umstrittenen Verfügungen zu Geburts- und Einwanderungsrechten einräumte, hat selbst die drei Frauen starke liberale Minderheit am Gericht begonnen, sich in ihrer juristischen Reaktion zu spalten. Und unter dem Druck wüster Angriffe in den sozialen Medien sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Richterinnen persönlich geworden.
Die 54-jährige Richterin Ketanji Brown Jackson, die erste schwarze Frau und jüngstes Mitglied des Obersten Gerichts, verfasste eine vernichtende Stellungnahme, in der sie Donald Trumps umstrittene Verordnung zum Geburtsrecht als „existenzielle Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnete. Selbst ihre beiden liberalen Kolleginnen gingen in ihrem Dissens mit der 6:3-Mehrheitsentscheidung zum “birthright” nicht ganz so weit mit ihrer Kritik am Präsidenten, der plötzlich das Recht aller in den USA Geborenen auf Staatsbürgerschaft in Frage stellt.
Ihre konservative Kollegin Amy Coney Barrett wiederum warf Jackson vor, „konventionelles juristisches Terrain“ zu verlassen, wenn sie schreibe, dass die Durchführungsverordnungen des Präsidenten „eine Zone der Gesetzlosigkeit“ schaffen. Und in der Tat, Jacksons jüngste Stellungnahmen machen ihre Einschätzung deutlich, dass der juristische Widerspruch politischer werden muss, wenn die Demokratie in Gefahr ist.
Beide Richterinnen stehen unter enormem Druck, der in den sozialen Medien aufgebaut wurde. Die New York Times berichtet über die Hintergründe der Kontroverse: „Richterin Barrett wurde von der Rechten wegen geringfügiger Abweichungen von Herrn Trumps juristischer Agenda heftig kritisiert; einige seiner Verbündeten nannten sie eine DEI-Ernennung und behaupteten damit, sie sei nur wegen ihres Geschlechts ausgewählt worden.“ Dieselben Kritiker feiern nun Barretts pointierte Kritik an ihrer liberalen Kollegin als positives Ergebnis ihrer früheren Angriffen auf die konservative Richterin, die jetzt endlich die Erwartungen des Präsidenten erfüllt.
Was als langfristige Polarisierung des Justizsystems begann und sich - ausgelöst durch die Abtreibungsfrage - zu einer dramatischen Politisierung des Obersten Gerichtshofs der USA beschleunigt hat, führt nun zu persönlichen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs über die grundlegende Frage, was zu tun ist, wenn die Exekutive Anordnungen der Gerichte missachtet. Und diese für jede Demokratie fundamentale Frage wird jetzt in den sozialen Medien behandelt wie ein juristisches Spektakel, in dem die Ernennungen und Meinungen von Verfassungsrichtern Teil des andauernden Kulturkampfes geworden sind. Deutschland hab Acht!
Schön und gemein - Donald Trumps Big Beautiful Bill im US-Kongress
Donald Trump hat das „Branding“ auf ein neues Niveau gehoben. Er verkaufte dem US-Kongress einen Gesetzentwurf, der gemein und hässlich ist als „groß und schön“. Er hat seinen Populismus in einen „umgekehrten Robin Hoodismus“ verwandelt. Er beraubt die Schwächsten der Gesellschaft ihrer Krankenversicherung und gewährt den Reichen Steuererleichterungen in Millionenhöhe. Warum? Weil er es kann. Und wie? Weil die Republikanische Partei, wie andere Parteien in der Geschichte des Faschismus, mittlerweile „gleichgeschaltet“ ist. Bisher stellte sich die Frage, warum viele Republikaner Donald Trump wählten, dies aber gegen ihre eigenen Interessen taten. Nun, auf dem Weg zu einem Autoritarismus Trump ’scher Prägung stellt sich die Frage, warum republikanische Senatoren und Kongressabgeordnete gegen die Interessen vieler Wähler – und damit gegen ihre eigenen – stimmten. Und was dies für die Zukunft der amerikanischen Politik bedeutet.
Donald Trump hat das „Branding“ auf ein neues Niveau gehoben. Er verkaufte dem US-Kongress einen Gesetzentwurf, der gemein und hässlich ist als „groß und schön“. Er hat seinen Populismus in einen „umgekehrten Robin Hoodismus“ verwandelt. Er beraubt die Schwächsten der Gesellschaft ihrer Krankenversicherung und gewährt den Reichen Steuererleichterungen in Millionenhöhe. Warum? Weil er es kann. Und wie? Weil die Republikanische Partei, wie andere Parteien in der Geschichte des Faschismus, mittlerweile „gleichgeschaltet“ ist. Bisher stellte sich die Frage, warum viele Republikaner Donald Trump wählten, dies aber gegen ihre eigenen Interessen taten. Nun, auf dem Weg zu einem Autoritarismus Trump ’scher Prägung stellt sich die Frage, warum republikanische Senatoren und Kongressabgeordnete gegen die Interessen vieler Wähler – und damit gegen ihre eigenen – stimmten. Und was dies für die Zukunft der amerikanischen Politik bedeutet.
Am 4. Juli, dem Geburtstag der Nation, unterzeichnete Präsident Trump ein Gesetz, das im Laufe des nächsten Jahrzehnts schätzungsweise 12 Millionen Bürgern ihre Krankenversicherung (Medicaid) entziehen wird. Steuergutschriften für erneuerbare Energien werden drastisch gekürzt. Gleichzeitig sieht das „Big Beautiful Bill“ (BBB) massive Steuersenkungen für wohlhabende Amerikaner vor. Dies wird das ohnehin schon aufgeblähte Haushaltsdefizit um weitere 4,3 Billionen Dollar erhöhen. Zudem sind 170 Milliarden Dollar für drastische Maßnahmen gegen Immigranten vorgesehen, für den Bau von Aufnahmelagern und die lange versprochenen Grenzmauer – eine Erhöhung des Budgets der Einwanderungsbehörde (ICE) um 265 %. Damit entsteht ein „einwanderungsfeindlicher Polizeistaat in Amerika“, wie Bill Clintons ehemaliger Arbeitsminister Robert Reich es formulierte.
Kritiker beschreiben das 870 Seiten lange Megagesetz mit einer Litanei empörter Kommentare: „Das monströseste Gesetz, über das ich während meiner Zeit im Kongress je abgestimmt habe“ (Senator Chris Murphy); „Die Katastrophe, die gerade den Senat passiert hat“ (Podcaster Ezra Klein); „Ein Paradebeispiel für fiskalische Inkontinenz und ideologische Erschöpfung“ (The Economist).
In der Tat geht die Wirtschaftlichkeit des Gesetzes nicht auf. Andere republikanische Präsidenten wie Ronald Reagan und George W. Bush haben ihre eigene „Voodoo-Ökonomie“ praktiziert, aber das geschah zu einer Zeit, als sich die Vereinigten Staaten noch leisten konnten, verschwenderisch zu sein. Danach gelang es demokratischen Präsidenten wie Carter und Clinton, die aus den Fugen geratenen Staatsfinanzen wieder in den Griff bekommen. Diesmal, da sind sich die meisten Kritiker einig, wird es anders sein. Amerika wird mit einer Staatsverschuldung von 120 % des Bruttoinlandsproduktes und einem jährlichen Haushaltsdefizit von etwa 7 % dastehen, was seinen Status als Supermacht dauerhaft untergraben wird.
Doch wie konnte ein so rücksichtsloses Gesetz zustande kommen? Was hat republikanische Abgeordnete zu Marionetten nordkoreanischen Verschnitts gemacht? Was erklärt ihre kollektive Rückgratlosigkeit angesichts einer Politik, die ihren Wählern insbesondere im amerikanischen Hinterland schaden wird, wo Medicaid die Versorgung von mehr als 40 % der in den ländlichen Bezirken Kentuckys, Alabamas und Mississippis geborenen Kinder abdeckt?
Als ich die Leute auf meiner Reise durch die Mitte Amerikas im April und Mai fragte, ob sie denn keine Angst hätten, dass Donald Trump ihre Medicaid-Leistungen kürzen könnte, antworteten die meisten, dies werde er nicht wagen. Und viele republikanische Kandidaten hatten im Wahlkampf versprochen, sie würden es nicht zulassen, dass jemand diese Krankenversicherung für Geringverdiener, Senioren und Behinderte antastet. Nun, mit seinem BBB hat er es gewagt, und sie haben nachgegeben.
Doch warum haben fast alle republikanischen Kongress-Abgeordneten das „Big and Beautiful Bill“ unterzeichnet? Erstens, weil es einige Kernversprechen aus Donald Trumps Wahlkampf enthielt: die vorübergehenden Steuersenkungen aus seiner ersten Amtszeit dauerhaft zu machen; die Initiativen der Biden-Administration für saubere Energien zurückzufahren; die Ausgaben für Grenzschutz und die Deportation illegaler Einwanderer zu erhöhen; und die Einkommensteuer auf Trinkgelder und Überstunden für Beschäftigte im Gastgewerbe abzuschaffen.
Zweitens, weil die meisten republikanischen Abgeordneten den gesunden Menschenverstand und ihr politisches Urteilsvermögen verloren haben. Manche sind von ihrem politischen Meister Donald Trump hemmungslos begeistert und nutzen die Dynamik, die er geschaffen hat. Andere glauben vielleicht sogar an die absurden Berechnungen, dass das aufgrund von Steuererleichterungen erhoffte Wirtschaftswachstum und die Einnahmen aus neuen Zöllen die Haushaltsbilanz ausgleichen werden. Manche Volksvertreter mögen mittlerweile gegen jegliche Warnungen vor einer drohenden Katastrophe oder einer Schädigung ihrer politischen Karriere immun sein, weil doch bisher alles gut gelaufen ist. Und in der Vergangenheit trafen Kürzungen im Sozialsystem eh vor allem demokratische Wähler. Was solls! Dass viele dieser Wähler nun Mitglieder der neuen republikanischen Koalition geworden sind, ist den meisten republikanischen Abgeordneten noch nicht bewusst. So triumphiert Ideologie über jedes politische Verständnis.
Drittens, und das ist am wichtigsten, wird ihre Speichelleckerei von der Angst getrieben, bei der nächsten Wahl den Sitz zu verlieren, weil der Präsident damit droht, Neinsager zu bestrafen, indem er bei den nächsten republikanischen Vorwahlen Jasager als Gegenkandidaten unterstützt. Unter Donald Trump ist die Republikanische Partei zu einer Partei der Angst geworden.
Aber sollten die Demokraten nicht froh über den Akt der politischen Selbstverletzung sein, den ihre politischen Gegner gerade begehen? Vielleicht. Angesichts der negativen Umfragewerte zum BBB sollte dessen Verabschiedung ihre Chancen bei den Zwischenwahlen im November 2026 und bei den Präsidentschaftswahlen zwei Jahre später erhöhen.
Aber wer weiß, welche politischen Bedingungen die erfolgte Gleichschaltung der Republikanischen Partei, der fortschreitende Abbau des Rechtsstaates, die systematische Zerstörung demokratischer Institutionen und die Ersetzung des öffentlichen Diskurses durch eine plattformgetriebene Influencer-Kultur bis dahin geschaffen haben.
Donald Trumps dramatisch-knapper Abstimmungserfolg im Kongress ist nur die jüngste Machtdemonstration eines siegreichen aber auch größenwahnsinnigen Präsidenten in einem degradierten politischen Umfeld. Da waren seine performative Bombardierung iranischer Atomanlagen und sein Sieg über die NATO-Verbündeten in Brüssel in Bezug auf die 5%-Forderung bei den Verteidigungslasten. Da gab es den dramatischen Beginn seiner Anti-Einwanderungskampagne in Los Angeles und das gefeierte Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das die Möglichkeit von Bundesrichtern einschränkt, Trumps Dekrete und die Politik seiner Regierung zu blockieren. Und es gibt besser als erwartete Wirtschaftsdaten sowie Rekordhochs an der Börse, die den düsteren Vorhersagen seiner liberalen Kritiker zumindest vorerst zu widersprechen scheinen.
Nach seinem großen, schönen Sieg im Kongress am Vorabend des Unabhängigkeitstages ist Donald Trump völlig außer Rand und Band. Oder um den Demokratischen Ex-Minister Robert Reich noch einmal zu zitieren: „Dass ein so regressives, gefährliches, gigantisches und unpopuläres Gesetz den Kongress passieren konnte, zeigt, wie weit Trump Amerika in einen neuartigen Faschismus hineingezogen hat.“
Der wankelmütige Strongman im Weißen Haus
Am Anfang sah es so aus, als wäre die israelisch-iranische Herausforderung Amerikas der erste Stresstest für die MAGA-Bewegung. Dann offenbarte Trumps anfängliches Zögern vor einer weiteren militärischen Intervention im Nahen Osten die Schwäche der Demokratischen Partei, die bei dieser Entscheidung über Krieg und Frieden nicht die Mitsprache des US-Kongress einforderte. Schließlich warnten konservative Kritiker wie Robert Kagan vor den gefährlichen Folgen eines solchen Kriegseintritts: „Er wird autokratische Tendenzen im eigenen Land und antiliberale Kräfte weltweit stärken.“ Doch bisher ist der „Zwölf-Tage-Krieg“ nur ein weiteres Kapitel in der zweiten Amtszeit des wankelmütigen strongman im Weißen Haus, der vor allem seine narzisstischen Impulse befriedigt
Am Anfang sah es so aus, als wäre die israelisch-iranische Herausforderung Amerikas der erste Stresstest für die MAGA-Bewegung. Dann offenbarte Trumps anfängliches Zögern vor einer weiteren militärischen Intervention im Nahen Osten die Schwäche der Demokratischen Partei, die bei dieser Entscheidung über Krieg und Frieden nicht die Mitsprache des US-Kongress einforderte. Schließlich warnten konservative Kritiker wie Robert Kagan vor den gefährlichen Folgen eines solchen Kriegseintritts: „Er wird autokratische Tendenzen im eigenen Land und antiliberale Kräfte weltweit stärken.“ Doch bisher ist der „Zwölf-Tage-Krieg“ nur ein weiteres Kapitel in der zweiten Amtszeit des wankelmütigen strongman im Weißen Haus, der vor allem seine narzisstischen Impulse befriedigt.
Tagelang hatten US-amerikanische und deutsche Medien den Online-Schlagabtausch zwischen den selbsternannten Anführern der MAGA-Basis verfolgt, zwischen dem Chefideologen Steve Bannon, dem ehemaligen Fox-Moderator Tucker Carlson, dem Talkshow-Influencer Charlie Kirk und der Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green auf der einen, und traditionellen Republikanern wie den Senatoren Ted Cruz und Lindsey Graham auf der anderen Seite. Unter der Schlagzeile „Wie der Iran-Krieg die MAGA-Bewegung spaltet“ berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ über den feindselig klingenden Schlagabtausch in der Blogosphäre und fragte, wie gefährlich dieser für Donald Trump sein könnte.
Nicht sehr gefährlich, wie sich herausstellte. Die Gefahr liegt eher in einem falschen Verständnis von Politik im Zeitalter Donald Trumps. Denn die aktuelle republikanische Koalition aus lautstarken Influencern und gefügigen Abgeordneten ist ein völlig anderes politisches Konstrukt als die demokratische Koalition aus einer traditionellen politischen Partei mit verschiedenen Fraktionen und einer frustrierten, hilflosen Zivilgesellschaft. Die Mitglieder der republikanischen Koalition sind allesamt Speichellecker in einem halbautokratischen System, während sich die Opposition in ihrem politischen Abseits derzeit auf nichts einigen kann. Die erste Gruppe liefert eine abscheuliche, aber unterhaltsame Polit-Show, die zweite führt immer wieder die ersten Akte einer bekannten Tragödie auf, ohne jemals bis zur Katharsis zu gelangen.
Der Nahe Osten war der ursprüngliche Ausgangspunkt der MAGA-Bewegung. Es war Donald Trump, der bereits in seinem ersten Wahlkampf erkannte, wie unpopulär die Außenpolitik der Demokratischen Partei nach dem Desaster der „ewigen Kriege“ im Irak und in Afghanistan war. Er spürte, wie erschöpft die amerikanische Öffentlichkeit nach diesen gescheiterten Interventionen war, die nach Ansicht der meisten Menschen zu Lasten ihres wirtschaftlichen Wohlergehens im eigenen Land gingen. „All das Geld, das man für mich hätte ausgeben können, wurde verschwendet“, ist ein Satz, den man noch heute hört. Steve Bannons Behauptung, 80 % der MAGA-Anhänger wären gegen ein US-Engagement an der Seite Israels, dürfte übertrieben sein. Aber alle Umfragen bestätigen, dass sowohl Demokraten als auch Republikaner einen Kriegseintritt mit deutlicher Mehrheit ablehnen.
„Dies könnte eine verpasste Chance für die Demokraten sein, zur Antikriegspartei zu werden“, schrieb der britische „New Statesman“, „eine Position, die Trump seit seinem Wahlsieg 2016 unangefochten einnimmt.“ Tatsächlich gibt es eine Übereinstimmung der Ansichten zum aktuellen Konflikt zwischen Israel und dem Iran zwischen MAGA-Anhängern und einigen Vertretern der demokratischen Linken wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Doch die derzeitige Führung der Demokratischen Partei wiederholt immer wieder die Fehler Hillary Clintons und ihrer Parteigänger, als sie Anfang 2003 nicht den politischen Mut aufbrachten, sich gegen Präsident Bushs Invasion in Irak auszusprechen.
Es gibt zwar den War Powers Act von 1973, der die Position des Kongresses stärkte, nachdem Präsident Richard Nixon während des Vietnamkriegs zu viel außenpolitische Macht an sich gerissen hatte. Doch als es jetzt erneut darum ging, einem Kriegseintritt zu widersprechen, war von den Führern der Demokratischen Partei im Kongress nicht viel zu sehen. Und dies nach einer Woche, in der die US-Demokraten eigentlich in Hochstimmung sein sollten, nachdem sie Millionen Demonstranten gegen die Razzien und die Einwanderungspolitik der Trump-Administration auf die Straße gebracht hatten. Der ehemals neokonservative, jetzt reumütige Kolumnist Peter Beinart bezeichnet dies in der „New York Times“ als „schweren außenpolitischen Fehler“ der demokratischen Kongressführung.
Doch warum kann die Drohung mit einem weiteren unpopulären Kriegseintritt die Demokratische Partei verzagen lassen, während sie der Trump-Regierung keinen Schaden zufügt? Weil die MAGA-Bewegung ihren Groll und ihre Galle schnell der neuen Situation anpassen kann, und weil den Republikanern im Kongress nichts anderes übrig bleibt, als dem oszillierenden Trumpismus zu verfallen. Denn für Donald Trump ist es kein großer Aufwand, die isolationistische Melodie von gestern in eine Hymne auf den Krieg umzuwandeln. Dies ist nichts anderes als außenpolitisches TACO, der Kurzform für „Trump always chickens out“ (Trump verdrückt sich immer). Mit diesem Ausdruck bezeichnete die “Financial Times” seine Wendungen in der Zollpolitik und die Art und Weise, mit der sich der Präsident häufig vor dem Einlösen seinen Versprechen drückt. In diesem Fall machte Trump einen Rückzieher von seinem martialisch geäußerten Wahlkampfversprechen: „Keine Kriege mehr!“
Trumps „neuer Neokonservatismus ist eine Weiterentwicklung“, wie Bruno Macaes im „New Statesman“ ausführt. „Er hat den blassen Schimmer von Idealismus verloren, den er einst hatte und sich in eine durch und durch nihilistische Ideologie verwandelt, die offen rohe Gewalt befürwortet.“ Damit wird Trump bei seinen Anhängern durchkommen, die grausame Spektakel aller Art mögen, solange sie anderen schaden. Und in einer politisch erschöpften Öffentlichkeit lässt sich mit dem Beginn des Krieges dann auch das traditionelle Schema von „Gut gegen Böse“- leicht wiederbeleben.
Es ist ironisch, dass es diesmal einem anderen Neokonservativen und Befürworter des Regimewechsels in Irak wie Robert Kagan zufiel, seine Landsleute vor den Gefahren eines Krieges gegen den Iran zu warnen. Da die Vereinigten Staaten „auf dem besten Weg in die Diktatur im eigenen Land sind“, argumentierte er im Magazin „The Atlantic“, „kann ich mir derzeit nichts Gefährlicheres für die amerikanische Demokratie vorstellen, als in den Krieg zu ziehen.“
Kagan beschreibt mögliche Ausreden, die Trump vorbringen könnte, um die diktatorische Kontrolle im eigenen Land zu stärken; wie drakonisch er in Kriegszeiten oder nach möglichen Terroranschlägen mit Andersdenkenden umgehen könnte. „Jeder Erfolg, den Trump im Iran für sich beansprucht, wird, ungeachtet seiner sonstigen Folgen, ein Sieg für die antiliberale Allianz sein und die Interessen des Antiliberalismus auf der ganzen Welt fördern.“
Das könnte so sein. Doch derzeit verfolgt Donald Trump eine „schwindelerregende Iran-Politik“, wie die „Financial Times“ anmerkt. Seinem Truth-Social-Account zufolge geht es heute um einen Regimewechsel und morgen um Diplomatie – ein getweetetes Skript, das zwischen militärischen Drohungen gegen den Iran und diplomatischen Abkommen mit seinem Regime, zwischen Grausamkeit und Großzügigkeit wechselt. Dies ist nicht etwa das Ergebnis einer gespaltenen Persönlichkeit, sondern das systematische Hin und Her eines Machthabers, der jedes Ergebnis als Erfolg für sich reklamieren möchte, sei es der „Zwölf-Tage-Krieg“ oder ein kurzlebiger Frieden. Die Befriedigung seines unersättlichen Narzissmus ist Donald Trumps ultimatives außenpolitische Ziel.
Trump und der Feind von Innen
Vor 251 Jahren stimmte der Erste Kontinentalkongress gegen die Aufstellung einer stehenden Armee, weil seine Mitglieder befürchteten, eine schlechte Regierung könnte eine solche Armee gegen ihr Volk aufhetzen. Letzte Woche wurden dies Befürchtung von Präsident Donald Trump bestätigt, als er beschloss, die Nationalgarde und die US-Marines gegen einen vermeintlichen Aufstand in Los Angeles einzusetzen. Am 14. Juni 1775 gründete der Zweite Kontinentalkongress schließlich eine US-Armee, da es keinen anderen Weg zu geben schien, die britische Kolonialmacht loszuwerden – eben jene Armee, die Donald Trump nun gegen den „inneren Feind“ aufhetzt.
Vor 251 Jahren stimmte der Erste Kontinentalkongress gegen die Aufstellung einer stehenden Armee, weil seine Mitglieder befürchteten, eine schlechte Regierung könnte eine solche Armee gegen ihr Volk aufhetzen. Letzte Woche wurden dies Befürchtung von Präsident Donald Trump bestätigt, als er beschloss, die Nationalgarde und die US-Marines gegen einen vermeintlichen Aufstand in Los Angeles einzusetzen. Am 14. Juni 1775 gründete der Zweite Kontinentalkongress schließlich eine US-Armee, da es keinen anderen Weg zu geben schien, die britische Kolonialmacht loszuwerden – eben jene Armee, die Donald Trump nun gegen den „inneren Feind“ aufhetzt.
Die Anzeichen für Trumps geplante Usurpation des amerikanischen Militärs aus politischen Gründen waren schon länger zu sehen. Im Jahr 2020, als die Black-Lives-Matter-Proteste das Land erschütterten, wurde sein Versuch, das „Aufstandsgesetz“ von 1807 anzuwenden, von Mitgliedern seiner eigenen Regierung und der Führung des Pentagon sabotiert, die verfassungsrechtliche Bedenken hegten und professionell handelten. Und im Oktober 2024 sagte er es ausdrücklich in einem Interview auf Fox-TV: „Der Feind von innen ist meiner Meinung nach gefährlicher als China, Russland und all diese Länder.“
Im November 2024 wiedergewählt, verbot Donald Trump Transgender-Personen den Militärdienst. Im Februar ließ er die Spitzenanwälte von Heer, Marine und Luftwaffe entlassen, weil er sie als Bremser seiner politischen Agenda ansah. Er ordnete an, sämtliches Material, das Themen zu “Rasse”, Geschlecht und Diversität behandelt, aus Bibliotheken und der Lehre an Militärakademien zu verbannen und alle Pentagon-Programme zu diesen Themen abzusetzen.
Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der Präsident Fernsehmoderatoren aus rechtsgerichteten Medien und Anhänger der MAGA-Bewegung in sein Kabinett und in wichtige Positionen seines nationalen Sicherheitsstabs berufen: Speichellecker, Schausspieler und Clowns des rechten Zirkus, deren Loyalität und Inkompetenz es ihnen dieses Mal nicht erlauben würden, seine politischen Befehle in bezug auf militärische Angelegenheiten zu unterlaufen.
Er setzte die Ernennung des FOX-TV-Moderators, hyperreligiösen Schürzenjägers und offensichtlichen Trunkenbolds Pete Hegseth zum Verteidigungsminister durch, nachdem selbst sein erster Kandidat für das Amt zu extrem war, um den Ausschuss zu passieren. Und in der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, fand er seinen Idealtyp einer Politikerin – Maskengegnerin, Waffenbefürworterin und voller Verehrung für ihren Präsidenten.
Beunruhigend ist nicht nur, dass Trump solch fragwürdige Persönlichkeiten in hohe Ämter berufen konnte, sondern mehr noch, dass sie trotz ihrer blamablen Auftritte vor den Kongressausschüssen von den republikanischer Abgeordneten weiterhin vor Kritik in Schutz genommen werden. Sie mögen zwar ein permanentes Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten darstellen, doch das scheint die gewählten Vertreter von „America First“ nicht zu stören.
Manche Beobachter bagatellisieren die Situation in der Hoffnung, viele von Trumps Executive Orders, Maßnahmen oder Ernennungen seien vorwiegend performativer Art oder würden nicht von Dauer sein. Das war schon immer naiv. Doch seit letzter Woche sind solche Entschuldigungen leichtsinnig und gefährlich.
Was also ist in den letzten Tagen zwischen Los Angeles, North Carolina und Washington, D.C. geschehen, das Freunde und Feinde des Trump-Regimes – und selbst seine Verbündeten im Ausland – beunruhigen sollte?
Am 21. Mai drängten Trumps persönlicher Berater Stephen Miller und Heimatschutzministerin Kristi Noem die Leiter der Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement), täglich 3.000 „illegale Einwanderer“ festzunehmen, um Trumps Wahlversprechen umzusetzen, eine Million von ihnen zurückzuschicken. Dies würde die jährliche Abschiebungsraten unter den Präsidenten Obama und Biden vervierfachen. Was von lokalen ICE-Einheiten im ganzen Land bisher planlos praktiziert wurde, sollte nun koordiniert, intensiviert und - der größeren Wirkung wegen - auf die Großstädte ausgeweitet werden.
Als ICE-Einheiten am ersten Juniwochenende begannen, nicht-weiße Arbeiter vor dem Home Depot Store in Central Los Angeles festzunehmen, kam es zu Protesten der lokalen Latino-Bevölkerung. Andere schlossen sich den Demonstrationen an, die jedoch auf wenige Häuserblocks in der Innenstadt beschränkt blieben. Wo es zu Gewalt kam, handelte es sich allenfalls um ein lokales Scharmützel, das von der nie zimperlichen Polizei von Los Angeles leicht hätte bewältigt werden können.
Da Kalifornien jedoch eine Hochburg der Demokraten ist und Los Angeles – in konservativen Augen – schon immer eine “Stadt der Sünde” war, schickte Verteidigungsminister Peter Hegseth die Nationalgarde und die US-Marines dorthin, mit der Absicht, den demokratischen Gouverneur Gavin Newsom in Verlegenheit zu bringen und durch dramatische Fernsehbilder die Unterstützung der Bevölkerung für Trumps Abschiebeprogramm zu stärken.
Gerichte erklärten den Einsatz der Nationalgarde ohne echten Notfall für illegal. Gouverneur Newsom hielt eine kämpferische Rede, in der er die demokratische Ordnung gegen die Übergriffe der Bundesmacht aus dem Weißen Haus verteidigte – doch ohne Erfolg. Die Bilder lieferten der Regierung genau das, was sie wollte, um die Mehrheit der Bevölkerung für ihr Abschiebeprogramm zu gewinnen. Nicht ohne Erfolg. Die konservativen Medien feierten diese Aktion. Die nationalen Umfragen sind noch nicht eindeutig, aber etwa die Hälfte der Bevölkerung scheint eine strengere Einwanderungspolitik zu befürworten, obwohl Trump bei der Frage des Militäreinsatzes wohl einige Wähler verliert.
Das inszenierte Chaos zeigte auch das Versagen der traditionellen Medien in einem Umfeld, das sich seit den Unruhen in Los Angeles von 1992 oder den landesweiten „Black Rights Matter“-Protesten von 2020 völlig verändert hat. Selbst die Berichterstattung des sonst eher ausgewogenen Kabelsenders CNN vermittelte den Zuschauern den von der Regierung geschürten Eindruck, in Los Angeles die Hölle los. Ein vermummter Jugendlicher, der eine Wasserflasche auf die Polizei wirft, war für die live-Berichterstattung deutlich attraktiver als Tausende, die nur einen halben Kilometer entfernt ungestört ihren Wochenendeinkauf erledigten.
Diese Veränderungen in der Medienlandschaft sind von großer Bedeutung, nicht zuletzt für die Demokratische Partei. Nostalgische Demokraten, die sich einen zweiten Obama wünschen, schreibt Tressie McMillan Cottom in „The Atlantic“, vergessen dabei, „dass dieses Land nicht mehr das gleiche ist”. Sie meint damit das Jahr 2008, zur Zeit des iPhone 3G, in dem mit Twitter gerade ein webbasierter Diskurs entstand und „ein Präsident stark von einer Medienwelt profitierte, in der wir dieselbe Realität teilten“. 2012 begann dann der Wandel vom offenen Internet hin zu einer online-Welt, in der die Algorithmen der großen Technologieunternehmen den Medienkonsum steuerten.
Dies war also schon bei den Protesten von Black Lives Matter der Fall, doch seitdem haben extremistische Influencer die rechte Propaganda in einem stark polarisierten Medienökosystem weiter verstärkt. Und nachdem Elon Musk 2022 Twitter kaufte, verwandelte es sich von einer Diskursplattform in eine Medien-Maschine, die nur noch die Meinung der Menschen wiedergibt und rechtfertigt. Was auch immer diese rechten Influencer sagen und tun, argumentiert McMillan Cottom: „Die wahre Macht liegt bei der Plattform, die diese Popularität verstärkt und sie vor Kritikern schützen kann.“
Der US-Kongress hat es also versäumt, die Neutralität und Professionalität der Streitkräfte zu gewährleisten. Und eine zersplitterte Medienlandschaft kann keine gemeinsame Realität mehr schaffen, weder in Los Angeles noch anderswo. Und das Militär selbst?
Während sich das Spektakel in Los Angeles abspielte, hielt Präsident Trump in Fort Bragg eine sehr parteiische Rede. Er trug seine MAGA-Mütze, griff den Gouverneur von Kalifornien an und verleitete die jungen Rekruten dazu, seiner politischen Agenda zu folgen – d. h., er missachtete alle militärischen Traditionen und die Regeln zivilen Benehmens. Und niemand aus der von ihm ernannten militärischen Führung wagte es, ihrem Oberbefehlshaber die Stirn zu bieten, wie es in einer bedrohten demokratischen Ordnung seine Pflicht gewesen wäre. „Das Schweigen der Generäle“, titelte „The Atlantic“. Allein der Philosophieprofessor Graham Parsons an der West Point-Akademie übte offenen Widerstand, indem er im gleichen Magazin die Gründe für seinen Abschied von der renommierten Militärschule darlegte.
Die Militärparade, die am Samstag, dem 14. Juni, in Washington D.C. folgte, war so nur ein weiterer Akt in einer Woche militarisierter Spektakel. Die Kosten für die Kolonne schweren Panzern durch Straßen von Washington D.C. waren enorm, der Marsch der Soldaten grauenhaft, die Menschenmenge enttäuschend; und Donald Trump schlief beim Zuschauen von der Ehrentribüne fast ein. Doch endlich hatte „sein Militär“ nach seiner politischen Pfeife tanzen lassen.
Vieles, was in dieser Woche geschah, war als Rache für seine gescheiterten Vorhaben während seiner ersten Präsidentschaft gedacht: das Nichtzustandekommen einer Militärparade 2020, der ihm nicht erlaubte Truppeneinsatz während der „Black Lives Matter“-Proteste, sein gebrochenes Versprechen, Einwanderer aller Art abzuschieben.
Rückblickend dürfte dies die Woche gewesen sein, in der Donald Trump’s Show als starker Mann politische Wirklichkeit wurde, wie Susan Glasser im New Yorker schreibt. Und in der er das Militär gegen den “inneren Feind” richtete und damit „die nationale Sicherheit neu definierte“.
Die Militärparade am Samstag in Washington geriet mit weniger als 200.000 Teilnehmern zum Flop, während die am gleichen Tag stattfindenden „No Kings“-Proteste von Millionen Menschen im ganzen Land für die Opposition ermutigend waren. Doch das amerikanische Militär bleibt in den Händen einer durchgeknallten politischen Führung, mit Generälen, die in die Vorgefechte eines Bürgerkriegs schlafwandeln, der online bereits ausgetragen wird.
Leaving America
“Leaving America” ist der letzte blog post über meine Reise durch “Amerikas Hinterland” im April und Mai 2025. Es war eine Reise in meine persönliche Vergangenheit und die Gegenwart des Landes, und ich hoffe, dass es Euch gefallen hat, mich auf der ganzen Strecke oder auf einzelnen Etappen zu begleiten.
Ich plane, diesen Amerika Blog in unregelmäßigen Abständen mit Kolumnen, Analysen und Kommentaren von Europa aus weiterzuführen. Und ich würde mich freuen, wenn Ihr Euer Abonnement des Newsletter beibehalten würdet, der Euch über den jeweils nächsten Post von “what happened to America and why?” informieren wird.
Danke, und bis dann
Rolf Paasch
Ich verlasse Amerika mit schwerem Herzen. Es ist nicht mehr das Land, das ich zu kennen glaubte. Es ist, als hätten die Verrückten, die man immer in den Nischen dieses weitläufigen Landes finden konnte, die Zügel übernommen. Es ist ein Ort, an dem die Angst wächst und Empathie schwindet. Wo Wahrheit und Lüge nicht mehr zu unterscheiden sind, wo Extremismus zur Normalität geworden ist und Grausamkeit als Preis für politischen Wandel akzeptiert wird.
Wo sich Nachbarn früher über den Gartenzaun und über die politische Kluft hinweg unterhielten, herrscht jetzt betretenes Schweigen. Noch nie habe ich so viele Amerikaner getroffen, die nicht mehr reden wollten - aus Angst oder aus Scham: die Bundesangestellten in Washington, die plötzlich entlassen wurden, aber immer noch auf ihre Wiedereinstellung hofften; die medizinischen Forscher, deren Programme gekürzt wurden und deswegen besser nichts sagen sollten; Akademiker, die einfach nicht auf meine Interviewanfrage reagierten; die mexikanischen Einwanderer, die ihren Kindern beim Spielen auf einem Baseballfeld in Georgia zusahen und lieber schwiegen; oder die ausländischen Studenten auf einem Campus in Mississippi, die Angst vor der Abschiebung hatten. Andere wiederum schämten sich, einem Ausländer erklären zu müssen, was in ihrem Land vor sich geht.
Die Mitarbeiter von Amerikas großen Institutionen, die aus einer Zeit stammen, in der Gemeinsinn noch etwas galt, leben in Angst vor drohenden Kürzungen ihrer Fördergelder: Bibliothekare, Park Rangers, Journalisten des National Public Radio und der Public Broadcasting Corporation sorgen sich um ihre Zukunft und die ihrer Institution.
Die Angst ist überall spürbar. Manche fürchten die Verbrecherhorden die angeblich aus Lateinamerika kommend die Grenze nach Texas und Kalifornien überqueren. Andere fühlen sich unwohl, wenn haitianische Einwanderer die verlassenen Läden im Zentrum einer verfallender Industriestadt in Pennsylvania wieder eröffnen. Eltern sorgen sich, dass ihre Kinder in der Schule oder Universität durch linke oder „woke“ Propaganda „indoktriniert“ werden.
Für mich war dies ein Amerika, das sich stark verändert hatte. Der Patriotismus, der früher arrogant oder großzügig daher kam, hat einem engstirnigen und aggressiven Nationalismus Platz gemacht. Der Traum vom sozialen Aufstieg ist der Angst vor dem Abstieg gewichen. Mitglieder der schwindenden weißen Mehrheit sehen die Welt als Nullsummenspiel: wo sie verlieren, so glauben sie, müssen “die Anderen” gewinnen.
Trumps Amerika ist hin- und hergerissen zwischen Industrie-Nostalgie und der Angst vor Künstlicher Intelligenz. Im Rust Belt und in West Virginia sprach ich mit ehemaligen Industriearbeitern, die von einer Rückkehr zur Kohle träumten, während die Karriere ihrer Kinder durch KI bedroht wird. In Washington wiederum haben Politiker beider Parteien nicht die geringste Ahnung, wie sie mit der nächsten technologischen Revolution umgehen sollen.
Mehr als einmal fühlte ich mich wie der „Onkel aus Europa“, wenn ich auf die negativen Nebenwirkungen der Politik hinwies, für die meine Gesprächspartner gestimmt hatten. Sie reagierten gleichgültig, als hätten sie sich aus einem Leben, das auf Details und Fakten basiert, verabschiedet. Große und bedrohliche Themen wie “Klima” und “Kapitalismus” schienen Tabu zu sein. Ein Freund nannte diesen Zustand „vorsätzliche Ignoranz“.
Meine Reise war geprägt von der Diskrepanz zwischen den dystopischen Urteilen der liberalen Kommentatoren, die ich am Abend las, und der seligen Ignoranz der Konservativen, denen ich tagsüber begegnete. Wo bekannte Ökonomen und angesehene Kolumnisten regelmäßig den Zusammenbruch der Börse oder der internationalen Ordnung vorhersagten, zuckten die meisten Bewohner des ländlichen middle America nur mit den Schultern und sahen die Probleme ganz anders gelagert. Vielleicht waren sie einfach klug genug, all die unerhörten Äußerungen Donald Trumps zu ignorieren, die Intellektuelle und Demokraten so verstören, weil sie jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Für die Wähler Donald Trumps spielten Widersprüche keine Rolle, denn der Stolz, an der Wahlurne ein drastisches Statement abgegeben zu haben, schien ihnen mehr wert zu sein als das spätere Leid. Manche sprechen sich lieber für die Kürzung von Medicaid-Leistungen aus als für die Verbesserung ihrer Zahnhygiene; aus Stolz, nicht von staatlichen Zuwendungen abhängig zu sein, solange diese auch anderen verwehrt bleiben. Manchmal fiel es mir schwer, der emotionalen Logik von Trump-Anhängern zu folgen. Es war, als wollten sie sich selbst verletzen.
Wie schon immer hilft Religion den Menschen, Herausforderungen zu meistern und Widersprüche zu entschärfen, indem sie Logik durch Glauben ersetzt. Wenn ich den Vertretern der christlichen Rechten in Washington und den weißen Christen in den Kirchen des amerikanischen Südens zuhörte, faszinierte mich, wie sie ihr wörtliches Verständnis der Bibel mit der flexiblen politischen Anwendung ihres Glaubens in Einklang brachten.
Für ultrakonservative Republikaner im Kongress bietet Religion oft den letzten Zufluchtsort. Wenn ihnen in Kongressanhörungen oder Fernsehinterviews die Antworten und Argumente ausgehen, greifen diese gläubigen Verteidiger der Trump-Administration auf die Bibel und Gottes Willen zurück. Und auch die christlichen Wähler, die ich auf meinem Weg traf, instrumentalisierten gerne ihren Glauben, um der Realität mit ihren lästigen Widersprüchen zu entfliehen. So wurden Trumps religiösen Verfehlungen, die ihn eigentlich in ihre Version der Hölle verbannen müssten, als Taten eines Sünders entschuldigt, der bald das Licht sehen werde.
Sprache ist zum Reizthema geworden. Für Konservative war schon der vorgeschlagene Gebrauch eines Gender-Pronomens ein Wort zu viel, das sie ins Lager rechter Kulturkämpfer führte. Für Liberale war der konservative Gegenangriff auf die „woke“ Sprache ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Faschismus.
Auf X folgte ich den Trollen der MAGA-Bewegung, die vor „fremden Eindringlingen“, dem „tiefen Staat“ oder der Verweiblichung von Männern warnten und nationalistische Lösungen und Rache anboten. In der Main Street begegnete ich Bürgern, die der Politik einfach überdrüssig waren, ob sie nun Trump gewählt hatten oder nicht. „Die Zone mit Scheiße überfluten“, wie MAGA-Unternehmer Steve Bannon die Medienstrategie der Ultrarechten zur Machtübernahme nannte, hat offensichtlich funktioniert. Sie hat die konservativen Extremisten ermutigt und den Rest entpolitisiert.
Was ich von den Leuten hörte, war oft nur eine billige Kopie der vorgefertigten Phrasen, die vom rechten Fox TV oder vom linken Sender MSNBC bis zum Überdruss wiederholt wurden – starke Meinungen, die auf Ängsten oder Wunschdenken basierten. „Es musste was geschehen“ – „Die Demokraten haben das ganze Geld weggegeben“ – „Die Grenzen müssen geschlossen werden“ – „Zölle werden Amerika wieder groß machen“. Auf der anderen Seite hörte von Liberalen, wie sie Trump auch für alles verantwortlich machten, was die Demokraten nicht geschafft hatten; zum Beispiel Joe Biden rechtzeitig loszuwerden.
Ich war mit der Illusion nach Amerika aufgebrochen, ich könnte Menschen Fragen zu ihrem Leben stellen und dann verstehen, warum sie so und nicht anders handelten. Doch oft drehten sie meine Frage, was mit ihnen und ihrem Land passiert sei, um: „Sag Du es mir doch“, antworteten sie. Aus ihrer Weigerung, selbst darüber nachzudenken, sprach eine gewisse Orientierungslosigkeit.
Als ich die Menschen fragte, wie sie sich fühlten, lautete die häufigste Antwort: „Überwältigt“. Viele Bewohner des Hinterlandes sind überwältigt von ihrem Gewicht, der schieren Masse und dem prekären Zustand ihrer Körper, von der sichtbarsten Gesundheitskrise jenseits von Opioiden und Einsamkeit.
Überall begegneten mir Zeichen von Sucht und Abhängigkeit, die einem von Supermarktregalen, Restaurantmenüs, Diätprogrammen und Fernsehspots entgegenschreien und sofortige Linderung versprechen, sei es durch Pillen, Prediger oder eine rechte Politik, die Stolz predigt und Strafe verhängt, Grausamkeit mit Erlösung verbindet und Versprechen mit Fantasien vermischt. Manchmal kam ich mir vor wie auf einer Reise durch ein Land am Tropf von Drogen und politischen Fantasien.
Wenn es ein Buch gibt, das mir geholfen hat, einige der Phänomene zu verstehen, denen ich auf meiner Reise begegnet bin, dann ist es „Fantasyland“ von Kurt Anderson. Geschrieben während des Wahlkampfs von 2016, erklärt es Amerikas Neigung zum magischen Denken, von den protestantischen Anfängen bis zum heutigen „Fantasie-Industriekomplex“ mit Donald Trump als dessen „Apotheose“ – einem ehemaligen Reality-Star, der seinen Anhängern alles verspricht und für nichts haftet.
Anderson führt den Leser durch ein Amerika, „das von wahren Gläubigen und leidenschaftlichen Träumern, von Scharlatanen und ihren Opfern geschaffen wurde – und das uns im Laufe von vier Jahrhunderten für Fantasien empfänglich gemacht hat…“ Er zeichnet diese Geschichte der Fantasie nach, von den Hexenprozessen von Salem bis zum Schausteller und Zirkusveranstalter P.T. Barnum, von Hollywood bis zur Scientology, von Walt Disney bis Billy Graham, von Ronald Reagan bis Donald Trump.
Andersons Zusammenfassung: „Mische epischen Individualismus mit extremer Religion; verrühre Showbusiness mit allem anderen; lass das alles ein paar Jahrhunderte lang köcheln und ziehen; gieße das alles durch die 1960er Jahre, in denen alles erlaubt war, und durch das Internetzeitalter; das Ergebnis ist das Amerika, in dem wir heute leben, wo Realität und Fantasie auf seltsame und gefährliche Weise verschwimmen und miteinander vermischt sind.“
Dies entsprach der Welt, durch die ich reiste: in der die Polarisierung der Religion zur Polarisierung der Politik geführt hatte, in der die Grand Old Party zu einem Bund weißer Christen mutiert ist; in der meine Gesprächspartner „mit ihren Kirchen abstimmten“ und Master-Studenten Online-Influencer entscheiden lassen, welche Nachrichten sie glauben und welche nicht. Eine Welt, in der selbst eine Politik voller Anspielungen und Hass zur Unterhaltung verkommen ist.
Und die Demokraten, was ist mit ihnen passiert? Sie sind schockiert und tief verunsichert. Über die Jahre hatten sie die Arbeiterklasse verloren, weil sie grundlegende Alltagsthemen ignorierten, wie ich auf Fahrten durch den Rust Belt zu hören bekam. Mit ihrer Identitätspolitik, so erzählten mir gemäßigte Parteigänger, kappten die Demokraten den Bezug zum Leben und den Nöten der Wähler zwischen den urbanen Küstenstreifen und bemerkten nicht einmal, in welchem Ausmaß sie zur Partei der Eliten geworden waren.
Die Demokratische Partei missverstand Obamas Präsidentschaften als Sieg des Fortschritts. Das war richtig und falsch zugleich. Ich sprach mit weißen Wählern, für die Obama der Präsident war, für den das Land noch nicht bereit war. Für sie “war es einfach zu früh für einen Schwarzen im Weißen Haus“. Und ich sprach mit schwarzen Wählern, für die Obama nicht der Führer war, der er hätte sein können. Weil er regiert habe “wie jeder andere weiße Präsident”. Ohne das Thema race und die Siege Barack Obamas, da waren sich viele einig, wäre Trump nie Präsident geworden. Zuerst hielten die Demokraten die erste Trump-Präsidentschaft für einen Ausrutscher. Und indem sie Joe Biden nicht zum Rücktritt aufforderten, als es an der Zeit war, machten sie stattdessen dessen Präsidentschaft zu einem Zwischenspiel.
Bis zu ihrer Niederlage im November 2024 verstanden die Demokraten nicht das Ausmaß der kulturellen Entfremdung in Teilen der Wählerschaft, wie sehr ihre moralische Rechtschaffenheit in Fragen der Identität viele Bürger außerhalb der Großstädte verärgerte, wie sogenannte „Wokeness“ als Bedrohung für die eigenen Lebensverhältnisse wahrgenommen wurde. Selbst viele konservative Amerikaner hatten die Homo-Ehe und andere Gesetzesänderungen in Geschlechterfragen akzeptiert. Doch als es um die Einführung von Pronomen in die offiziellen Kommunikation oder um die Teilnahme transsexueller Athlethen an den Sportveranstaltungen ihrer Töchter ging, verwandelte sich die zögerliche Akzeptanz des „Anderen“ in eine wütende Gegenreaktion und eine defensive Rückkehr in eine binäre Welt.
Heute ist die Demokratische Partei entlang der Altersgrenze tief gespalten. Jeder Demokrat unter 35, den ich traf, plädierte für einen Linksruck und die Unterstützung einer progressiven jungen Führungspersönlichkeit wie Alexandria Octavio-Cortez (AOC), der klugen, eloquenten Kongressabgeordneten aus New York, die im April mit ihrer „Anti-Oligarchie-Kampagne“ links-liberale Massen anzog. Demokraten mittleren und höheren Alters argumentieren hingegen immer noch, dass es einen Gemäßigten wie Joe Biden braucht, um die nächste Wahl zu gewinnen. Nur jünger müsste er sein. Jenseits dieser Kluft gibt es keine Vision, eine solide Mehrheit der Bevölkerung zurückzugewinnen.
Ich sprach mit engagierten Demokraten, die in ihrer Stadt gegen die Politik Trumps marschierten oder mit Plakaten gegen die ultrarechte Abgeordnete in ihrem Wahlkreis protestierten. Aber ich traf keinen einzigen Parteiorganisator oder Aktivisten, der eine überzeugende Strategie darlegen konnte, um die Arbeiterklasse, unabhängige Wähler oder gar registrierte Republikaner zurückzugewinnen. Es fehlt ein demokratischer Populismus, der die politische Lage grundsätzlich verändern könnte. Kein einziger Trump-Wähler mit dem ich sprach würde für die Demokraten stimmen, sollte Trump mit seiner umstrittenen Politik scheitern. So groß ist die Abneigung gegen die Demokraten im konservativen Amerika.
Und doch: Es gibt Hoffnung für die Zwischenwahlen, wenn die Demokraten bessere Kandidaten finden, professionellere Kampagnen führen und genug Republikaner der Abstimmung fernbleiben. Wenn Trumps Zölle die Inflation weiter anheizen, seine Einwanderungspolitik fehlschlägt und der Machtkampf zwischen Tech-Oligarchie und MAGA-Bewegung eskaliert, könnten die Demokraten eine oder sogar beide Kammern des Kongresses zurückgewinnen. Viel wird davon abhängen, welchen politischen Weg die republikanischen Senatoren und Kongressabgeordneten vor den midterm elections einschlagen.
Aber selbst wenn die Demokraten im November 2026 den Senat oder das Repräsentantenhaus zurückerobern, wäre bereits erheblicher institutioneller und psychologischer Schaden angerichtet. Sie werden in einem Land agieren müssen, das eine schmerzhafte Rückkehr zur Realität durchläuft, in dem viele juristische Leitplanken abgebaut wurden und der Mangel an Empathie Teil des virtuellen wie realen Lebens geworden ist.
„Was ist mit Amerika passiert und warum?“, war die Frage, auf die ich Antworten suchte. Es gab viele Erklärungen, aber eine typische Reaktion meiner Gesprächspartner beschreibt die Situation besser als manche Analyse: „Wir wissen es nicht, aber irgendetwas musste geschehen!“ Dieses „Etwas“ erschien in Gestalt des geübten Blenders Donald Trump. Es war ein historischer Zufall, dass eine Bevölkerung, die ihren sozialen Abstieg und Statusverlust beklagte, auf Amerikas talentiertesten Scharlatan traf, der seinen grotesken Narzissmus in der internetgetriebenen Welt politischer Fantasien auslebte.
Die Hälfte der Amerikaner war bereit, sich von dem ehemaligen Reality-Star täuschen zu lassen, der mit rebellischer Begeisterung das Blaue vom Himmel versprach. Wussten seine Wähler, dass seine Versprechungen nicht ernst gemeint, sondern nur Schein waren? Nun, es spielte keine Rolle. Für Trump zu stimmen war wie ein Besuch beim American Wrestling: Man weiß, dass der Kampf nicht echt ist, genießt aber das Gut-gegen-Böse-Szenario der dargebotene Gewalt. Die Frage bleibt: Was passiert, wenn die Show vorbei ist?
Wie sieht das Szenario einer Rückkehr zur Realität aus? Die Trump-Administration dürfte sich früher oder später selbst zerstören - durch Inkompetenz, Korruption und interne Widersprüche. Erste Anzeichen waren zu beobachten, als die Clowns seines Kabinetts vor Kongressausschüssen auftauchten, als die Familie Trump damit begann, sich in der Kryptosphäre zu bedienen. Sie verdichten sich mit den zunehmenden Interessenkonflikten zwischen den Tech-Oligarchen und der MAGA-Bewegung.
Doch Donald Trump bleibt immer das Thema “Immigration”, um die Leidenschaften seiner Basis zu mobilisieren und die Sympathien einer beträchtliche Anzahl von Wählern zu gewinnen. Letztere mögen nicht unbedingt seine gesamte Politik gutheißen, aber den Präsidenten darin unterstützten, ihr Land gegen das zu verteidigen, was seine Regierung dann als als “Rebellion” und “inneren Feind” brandmarken wird.
Hinter diesen Szenarien verbirgt sich die entscheidende Frage, die nicht nur die USA betrifft: Was passiert, wenn Rechtspopulisten in einem politischen System scheitern, in dem die Rechtsstaatlichkeit geschwächt, die Öffentlichkeit zu einer „Informationsoligarchie“ verkommen und die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge völlig ausgehöhlt ist? Gibt es dann noch einen Weg zurück zur liberalen Demokratie? Oder kann das Chaos eines populistischen Scheiterns nur mit neuen - möglicherweise faschistischen - Illusionen gefüllt werden?
Auf meiner 4,500 Kilometer langen Reise durch das amerikanische Hinterland, in dem eine große Mehrheit für Donald Trump gestimmt hat, traf ich viele Menschen, die von Ängsten und Illusionen getrieben waren, nicht wenige mit Sympathien für einen starken Mann, aber niemanden, der sich wirklich ein autokratisches System wünschte.
Von Akademikern und Journalisten, die lieber schweigen
Sie haben sicher von der mutigen Harvard University gehört, die Präsident Trumps Versuch widersteht, die akademische Freiheit einzuschränken, die Amerika einst auszeichnete. Und Sie haben sicher von der feigen Columbia University gelesen, die seinen Zensurbefehlen nachgab. Aber Sie wissen vielleicht nicht, welche Auswirkungen der von der Trump-Administration ausgerufene Krieg gegen „wokeness“ an Universitäten, in öffentliche Bibliotheken und lokale Medien hat, dort, wo es nicht ums große Geld geht, kaum einer hinschaut und Widerstand schwierig wird; das heißt in den amerikanischen Kleinstädten, wo die Agenten der Einwanderungsbehörde (ICE) die örtliche Universität oder die Treffpunkte von Einwanderern besuchen, wo niemand weiß, was da genau passiert und Gerüchte die Runde machen. Hier soll es um die Leute gehen, die sich auf meiner Reise durch das „flyover country“ der Nachfrage entzogen, und um meine Spekulationen darüber, was sie dazu bewogen hat, meiner Bitte um ein Gespräch nicht nachzukommen.
Sie haben sicher von der mutigen Harvard University gehört, die Präsident Trumps Versuch widersteht, die akademische Freiheit einzuschränken, die Amerika einst auszeichnete. Und Sie haben sicher von der feigen Columbia University gelesen, die seinen Zensurbefehlen nachgab. Aber Sie wissen vielleicht nicht, welche Auswirkungen der von der Trump-Administration ausgerufene Krieg gegen „wokeness“ an Universitäten, in öffentliche Bibliotheken und lokale Medien hat, dort, wo es nicht ums große Geld geht, kaum einer hinschaut und Widerstand schwierig wird; das heißt in den amerikanischen Kleinstädten, wo die Agenten der Einwanderungsbehörde (ICE) die örtliche Universität oder die Treffpunkte von Einwanderern besuchen, wo niemand weiß, was da genau passiert und Gerüchte die Runde machen. Hier soll es um die Leute gehen, die sich auf meiner Reise durch das „flyover country“ der Nachfrage entzogen, und um meine Spekulationen darüber, was sie dazu bewogen hat, meiner Bitte um ein Gespräch nicht nachzukommen.
Ich hatte – nennen wir sie Anna – vor einigen Jahren bei meiner Arbeit in Ostafrika kennengelernt. Sie war eine junge, intelligente Masterstudentin der Psychologie an einer der besten afrikanischen Universitäten und hatte das Zeug dazu, weit zu kommen. Als ich hörte, dass sie an einer Universität im Bundesstaat Mississippi promovierte, rief ich sie an, um mich mit ihr zu treffen. Doch Annas erste Reaktion auf meine Anfrage war ungewöhnlich zurückhaltend. Sie müsse sich das noch überlegen und ihre Kommilitonen und Dozenten fragen, ob sie denn mit mir sprechen wollten. Wollten Sie nicht! Und Anna traute sich nicht einmal, unseren Austausch per WhatsApp fortzusetzen.
Es stellte sich heraus, dass Annas Universität Studierenden geraten hatte, das Land nicht zu verlassen, da sie möglicherweise nicht zurückkehren könnten; sie sollten nicht mit Journalisten oder Außenstehenden sprechen, da dies sie und die Institution in Schwierigkeiten bringen könnte. Zu wichtigen Themen tauschten sich die Studierenden untereinander nicht mehr über soziale Medien aus, sondern nur noch von Person zu Person, da sie gehört hatten, dass „Spione“ auf dem Campus seien, die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) informierten, um sie abschieben zu lassen.
Anna ist nur eine von 1,1 Millionen ausländischen Studierenden, die heute in den USA eingeschrieben sind. Laut „The Atlantic“ trugen sie im vergangenen akademischen Jahr 44 Milliarden Dollar zur US-Wirtschaft bei und sichern 378.000 Arbeitsplätze. Doch die aktuelle Angst auf dem Campus vor Abschiebungen geht nicht zuletzt auf die vergangenen Äußerungen des heutigen Vize-Präsidenten JD Vance zurück, der Universitäten 2021 zu „feindselige Institutionen“ erklärt hatte, die „aggressiv angegriffen“ werden müssten.
Annas Befürchtungen mögen teilweise auf Gerüchten beruhen, doch sie erfüllten ihren Zweck, Studierende und Lehrende zum Schweigen und zur Unterwerfung zu zwingen. Wie erfolgreich diese Einschüchterungen waren, stellte ich fest, als ich Professoren und Dozenten der Sozialwissenschaften kontaktierte, um mit ihnen über Geschichte, Politik, Religion und Donald Trumps Bildungsmaßnahmen zu sprechen. Niemand antwortete auf meine Anfragen, nicht einmal eine Begründung, man sei zu beschäftigt, kam zurück.
Als ich Anfang der 90er Jahre über die Vereinigten Staaten berichtete, lehnte niemand die Interviewanfrage eines deutschen Korrespondenten ab. Alle wollten mit mir sprechen und dem Ausländer stolz ihr Land erklären. Als ich damals durch das Hinterland reiste, war Europa für die meisten Menschen zwar weit weg, doch sie stellten dennoch Fragen über die Welt da draußen, sei es über den Fall der Mauer oder die Krise im Nahen Osten. Damals grassierte die Befürchtung, Japan würde das Land mit billigeren Computern und besseren Autos überschwemmen, doch dies trübte weder das innenpolitische Urteil der Bürger noch belastete es die internationalen Beziehungen.
Im Frühjahr 2025 war dies anders. Trump-Wähler erklärten mir immer wieder, warum drastische Maßnahmen nötig seien, um Amerika wieder zu alter Größe zu führen und China entgegenzutreten. Dagegen schienen viele Journalisten und Akademiker mit ihren Meinungen zu den Ereignissen in Amerika in den Untergrund gegangen zu sein.
Da war der Herausgeber einer Zeitung aus West Virginia, der weder ans Telefon ging noch auf E-Mails antwortete. Dasselbe galt für den Religionskorrespondenten einer Zeitung in Nashville oder den Kolumnisten einer Lokalzeitung in Georgia. Da war der Schuldirektor, der eloquent über die Nachteile des Heimunterrichts schrieb, aber mir zur Schulpolitik keine Auskunft geben wollte.
Da waren die Bibliothekare in Amerikas wunderbarem und gut ausgestattetem System öffentlicher Bibliotheken, die sich aus sehr verständlichen Gründen entschuldigten, manche von ihnen mutiger als andere.
Natürlich traf ich auch liberale Angehörige der professional classes, die mir in privaten Gesprächen ihr Herz öffneten – geprägt von Verzweiflung oder offener Feindseligkeit gegenüber Donald Trump und seinen Anhängern. „Was“, sagte ein Freund in Washington D.C. zu mir, „du fährst nach Dummfuckistan“, als er von meiner geplanten Route durchs Hinterland hörte. Er hatte versucht, Trumps Erstwähler 2016 zu entschuldigen, aber für diejenigen, die 2024 erneut für ihn stimmten, konnte er nur „tiefe Abscheu“ empfinden. „Ich bin verdammt wütend, dass Trump seit zehn Jahren mein Leben dominiert“, so ein anderer frustrierter Freund in Atlanta. Aber das waren Leute im Ruhestand, die ihre Meinung und ihren Ärger frei äußern konnten, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen.
Und dann gab es da noch die Akademiker an den „feindlichen Institutionen“, die linken Verwalter von „Wokeness“- und DEI-Programmen an Universitäten, wie die Republikaner sie beschreiben würden. Sie wollten partout nicht mit mir reden. Ich konnte sie anrufen, ihnen E-Mails schicken oder sie sie auf den Fluren ihrer Fakultäten der Geschichts- oder Sozialwissenschaft zur Rede stellen. Sie hatten keine Zeit, zeigten kein Interesse oder taten so, als hätten sie keine Ahnung, als ich ihnen direkte Fragen zu Kultur und Politik stellte.
Nach dem Studium der Biografien von Professoren und Doktoren an einigen Universitäten in den Südstaaten konnte ich ansatzweise die Argumentation konservativer Kritiker nachvollziehen, dass eine zufällige Expertise zu Randthemen traditionellere akademische Schwerpunkte verdrängt habe. Es war tatsächlich schwierig, einen Experten für meine eher bodenständigen Fragen zu finden – nicht zum Buddhismus in Bhutan, sondern zur Politik des amerikanischen Südens –, der dann meine Anfrage ohnehin nicht beantworten würde.
Da ich die verstummten Akademiker nicht nach den Gründen für ihr Schweigen fragen konnte, muss ich über die Gründe spekulieren. War es die Angst davor, Ärger mit der ebenso verschreckten Leitung ihrer Universität zu bekommen? Oder die Scham liberaler Demokraten, ihr Heimatland nicht mehr zu verstehen, geschweige denn erklären zu können? Ist das akademische Leben etwa so hektisch und herausfordernd geworden, dass keine Zeit mehr dazu bleibt, neugierige Besucher zu treffen?
Oder ist es der Schock darüber, dass die älteste moderne Demokratie plötzlich ein Orwells‘sches Szenario durchlebt? Sind diese Akademiker damit beschäftigt, „1984“ noch einmal zu lesen und sich dabei vorzustellen, sie wären nicht mehr in Tennessee oder Mississippi, sondern in „Ozeanien“ tätig; und sich zu überlegen, was sie in der Rolle des Protagonisten Winston Smith tun sollen?
Ich weiß es nicht, und ich frage mich, ob sie es genau wissen. Am Ende habe ich das Schweigen, der Leute, die mich nicht treffen wollten, als Warnung verstanden. Denn angesichts der Angst in Amerika heute sollten wir nicht ausschließen, dass sich ein ähnliches Szenario nicht morgen auch wieder in Europa entfalten könnte. Wären unsere Akademiker und Journalisten dann mutiger? Vielleicht sollten wir Europäer jetzt Sinclair Lewis’ dystopischen Roman „It can’t happen here“ lesen, in dem der Autor seine Landsleute Mitte der 30er Jahre vor der Nachahmung der europäischen Faschismen warnte.
“Race”, Grausamkeit und das Ende der Scham
Ehe ich am 12. April zu meiner Reise durch das amerikanische Hinterland aufbrach, saß ich mit Ron und Nick in ihrem Wohnzimmer in Washington, D.C. zusammen, um über Rassismus und Grausamkeit zu sprechen. Ron ist Professor für Psychologie und Theologie. Nick, ist Brite und blickt auf eine lange Karriere in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zurück. Er hat viel von der Welt gesehen. Wir sprachen über den Zusammenhang zwischen Christentum und amerikanischer Psyche und über die unterschiedlichen amerikanischen und europäischen Erfahrungen in Bezug auf eine Reihe kultureller Themen. Unsere Unterhaltung berührte viele Themen, zu denen sich später auch die Menschen äußerten, die ich auf meiner Reise traf; Themen deren Bedeutung mir erst klar wurde, als ich spät abends im Hotelzimmer durch die Fernsehkanäle zappte. Vielleicht lohnt es sich deswegen, die eher akademischen Analysen meiner Washingtoner Freunde über Trumps Amerika mit den persönlichen Begegnungen auf meinem fünfwöchigen Roadtrip über 4.500 Kilometer zu vergleichen.
Ehe ich am 12. April zu meiner Reise durch das amerikanische Hinterland aufbrach, saß ich mit Ron und Nick in ihrem Wohnzimmer in Washington, D.C. zusammen, um über Rassismus und Grausamkeit zu sprechen. Ron ist Professor für Psychologie und Theologie. Nick, ist Brite und blickt auf eine lange Karriere in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zurück. Er hat viel von der Welt gesehen. Wir sprachen über den Zusammenhang zwischen Christentum und amerikanischer Psyche und über die unterschiedlichen amerikanischen und europäischen Erfahrungen in Bezug auf eine Reihe kultureller Themen. Unsere Unterhaltung berührte viele Themen, zu denen sich später auch die Menschen äußerten, die ich auf meiner Reise traf; Themen deren Bedeutung mir erst klar wurde, als ich spät abends im Hotelzimmer durch die Fernsehkanäle zappte. Vielleicht lohnt es sich deswegen, die eher akademischen Analysen meiner Washingtoner Freunde über Trumps Amerika mit den persönlichen Begegnungen auf meinem fünfwöchigen Roadtrip über 4.500 Kilometer zu vergleichen.
Am Anfang der amerikanischen Erfahrung standen Grausamkeit und Rassismus. „In Europa“, sagt Nick, „konnten wir beides durch unseren Umgang mit dem Kolonialismus exportieren – wir wussten, was geschah, mussten es aber nicht sehen. Aber hier in den USA mussten sie damit leben. Uns Europäern hat es ein Erbe von Frömmelei und Heuchelei hinterlassen, den Amerikanern eine erstaunliche Toleranz, vielleicht sogar Begeisterung für Grausamkeit.“ In der frontier society war Grausamkeit weit verbreitet, sie war der Treibstoff einer expandierenden Nation. Und Rassismus war Amerikas „Nationale Sünde“, wie Abraham Lincoln es ausdrückte, er war „tief verwurzelt Psyche und Tradition unserer Nation“, um Martin Luther King zu zitieren. Und heute, sagt Nick, „ist „race“ das Bindemittel zwischen allen Faktoren, die Donald Trump an die Macht gebracht haben“.
Als schwarzer Psychologe kann Ron die zentralen politischen Botschaften aufzählen, welche die konservative Neuausrichtung über mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt haben. Richard Nixons Law-and-Order-Kampagne von 1968 war ein Gegenmittel zu den Antikriegsprotesten und Unruhen nach der Ermordung von Dr. Martin Luther King Jr. Angespornt durch die politische Rhetorik der Republikanischen Partei betrachteten Konservative Lyndon B. Johnsons „Great Society“ zunehmend als Versorgungsleistung für die Schwarzen.
Doch das gezielte messaging begann mit Ronald Reagan, der seinen Wahlkampf 1982 in Philadelphia, Mississippi, begann, wo nur 18 Jahre zuvor drei Bürgerrechtler ermordet worden waren. Später bediente er sich des Rassenthemas, indem er von schwarzen „Wohlfahrtsköniginnen“ sprach. Präsident Bush folgte 1988 mit seinem berüchtigten und den Wahlkampf entscheidenden „Willy Horton-Werbespot“, der mit der Angst der Weißen vor schwarzer Kriminalität spielte. 1992 kopierte der demokratische Kandidat Bill Clinton diese erfolgreiche Wahlkampfstrategie mit seinem „Sister Souljah“-Kommentar und positionierte sich als Mann der Mitte, indem er sich von den umstrittenen Äußerungen einer schwarzen Rapperin distanzierte.
Für Ron zeigte dieses „Schüren rassistischer Vorurteile“ lediglich, wie fragil die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung in Wirklichkeit waren. Diese hätten „nur das schlechte Gewissen weißer Amerikaner beruhigt und als Mechanismus der Verleugnung fungiert“. Damit wurde nur die Illusion aufrechterhalten, die Gleichheit aller sei mit der Bürgerrechtsgesetzgebung schon erreicht. Der Widerstand gegen Bürgerrechtsgesetze wuchs mit dem Aufkommen der Tea Party im Jahr 2008. Die Suche nach Sündenböcken nahm zu, „um die grotesken Ungleichheiten nach der Finanzkrise“ zu vertuschen. Mit seiner „Erlaubnis, wieder brutal zu sein“, sieht Ron Donald Trump „nicht als Ausnahmeerscheinung, sondern als Symbol für die fortschreitende „Desensibilisierung unserer Kultur“.
Und als Pfarrer einer liberalen Kirche hat Ron den parallelen Rechtsruck weißer Kirchen beobachtet, vom Fundamentalismus Jerry Fallwell‘s in den 80er Jahren bis hin zu den 89 % der Evangelikalen, die heute für Trump stimmen. Sein Urteil über diese Wähler ist hart und eindeutig: „Sie sind in erster Linie Fanatiker und erst in zweiter Linie Christen. Für sie ist die weiße Vorherrschaft wichtiger als der christliche Glaube.“ In diesen Erweckungs-Kirchen erkennt der ausgebildete Psychologe „moralische Verletzungen“, „ein verkrüppeltes Gewissen“, „einen Mangel an Empathie“ und „Erniedrigung durch ihr Bekenntnis zu Verleugnung, Verschleierung und der Suche nach einem Sündenbock“. In dieser rechtsgerichteten Version des Christentums, so fügt Ron hinzu, „ist der gesellschaftlich Andere zum Sünder geworden, der seine Strafe verdient“.
Für beide Freunde sind die politischen Auswirkungen des beschleunigten politisch-religiösen Rechtsrucks deutlich sichtbar, und sie empfinden den daraus resultierenden gesellschaftlichen Schaden als zutiefst beunruhigend. In der Welt der alternativen US-Medien erscheine Europa als ein „moralisch verkommenes Durcheinander.“ Nick erklärt, der alte Kontinent sei eine Bedrohung für Amerika, „weil er die klare, gottgegebene Zweiteilung von Gut und Böse, männlich und weiblich, schwarz und weiß untergräbt“. Russland ausgenommen, denn nur dieses Land hat es richtig gemacht – es hat sich zu einem weißen, christlichen Imperium entwickelt, das die Schwarzen aus dem Land und seiner Kirche ferngehalten hat. Während Sozialleistungen für die Bürger des „woke Europe“ immer noch als Errungenschaft ihrer Nachkriegs-Wohlfahrtsstaaten verstanden werden, betrachte das heutige konservative Amerika „Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen als weiße Steuergelder, die unverdienterweise an die schwarze Bevölkerung gehen“.
Soziale Medien haben mit ihren Mitteln Grausamkeit zum Zuschauersport gemacht, sagt Nick. „Die Menschen werden ständig mit Grausamkeit, der Instrumentalisierung von Rassismus und vom Leid anderer Menschen konfrontiert, das ihnen als Unterhaltung dargeboten wird. Es ist eine Sucht, die ständig gefüttert werden muss.“ Einwanderern Leid zuzufügen, kann über Monate eine solches Unterhaltungsangebot abgeben. „Aber wo endet das?“, fragt er. „Kann die Regierung genug Grausamkeiten anbieten, um die Kürzungen bei Medicaid zu kompensieren?“ Fünf Wochen nach unserem Gespräch deutet Donald Trumps „großer und schöner Haushaltsentwurf“ mit den geplanten Kürzungen bei Medicaid darauf hin, dass sie es kann.
Auf meiner Reise durch Amerikas Hinterland schimmerte diese mangelnde Empathie für bestimmte Gruppen oft in Anspielungen und Witzen durch, kamen rassistische Stereotype meist indirekt zum Ausdruck. Doch wenn der Moderator der Late-Night-Show „Gutfeld“ auf Fox TV und seine Gäste „erfrischend“ über die Ereignisse des Tages diskutieren, sind Abwertung und Grausamkeit gegenüber schwachen, behinderten, migrantischen oder schwarzen Bürgern Teil eines verächtlichen Diskurses über den politischen Gegner.
Wenn die Menschen, die ich traf, über umstrittene soziale oder demografische Dynamiken sprachen, waren es nie sie selbst, sondern immer ihre Nachbarn, die aufgrund ihrer rassistischen Vorurteile handelten. „Sie verließen die Stadt, weil sie das Gefühl hatten, die Schwarzen hätten die Macht übernommen.“ Und das immer wieder erlebte Nachplappern des Fox-TV-Jargons durch die Donald-Trump-Wähler in Gesprächen an der Bar, im Restaurant oder auf der Straße endete unweigerlich mit dem rassistisch aufgeladenen Satz, sie könnten nicht für die Demokratische Partei stimmen, „weil die unser ganzes Geld weggeben“.
Als meine beiden Freunde im zu 96 Prozent prodemokratischen Washington ein Bild von Amerika zeichneten, in dem ein psychopathischer und narzisstischer Anführer im Weißen Haus keine Regeln kennt, seinen Anhängern Grausamkeit statt Lebensqualität bietet und ihnen erlaubt, ihrer eigenen Grausamkeit und ihrem Rassismus freien Lauf zu lassen, klang das für mich zunächst ziemlich hart. Aber nach meinen – stets freundlichen – Treffen und Gesprächen mit Donald-Trump-Wählern in Kleinstädten und im ländlichen Amerika kann ich ihre Analyse nicht wirklich widerlegen.
Welche Herausforderungen müssen wir bewältigen, um Rassismus und weiße Vorherrschaft zu überwinden, die dem Aufstieg und der Herrschaft Donald Trumps zugrunde liegen? Ron hat aus der Perspektive eines lehrenden und praktizierenden Psychologen ausführlich darüber geschrieben. Um Fortschritte zu erzielen, so schlägt er vor, müssten die Amerikaner die „Leugnung von Rassismus/weißer Vorherrschaft“ angehen, ihre „gestörte Empathie“ wiederherstellen und lernen, „mit Scham umzugehen“. Er gibt als Erster zu, dass dies keine leichten Aufgaben für eine Gesellschaft ist, die sich in all diesen Bereichen zurückentwickelt. Die Leugnung weißer Vorherrschaft ist nach wie vor weit verbreitet; Vizepräsident JD Vance hat sich kürzlich von traditionellen Konzepten wie Mitgefühl und Empathie distanziert; und Donald Trump hat hinreichend gezeigt, dass er weder Anstand noch Scham kennt.
Bei einer Kongressanhörung im Jahr 1954, so erinnert sich Ron an eine historische Herausforderung ungezügelter Macht, hatte der antikommunistische und rassistische Senator Joseph McCarthy seine Befugnisse eindeutig überschritten, als er einen Unschuldigen belastete. Doch als ihn der mutige Oberbefehlshaber der US-Armee daraufhin vor dem Ausschuss stellte und fragte: „Haben Sie denn überhaupt keinen Anstand mehr?“, da beendete diese live im nationalen Fernsehen übertragene Frage die politische Karriere des mächtigen Senators. Donald Trump hingegen, so Ron, „hat seine gesamte Karriere auf dem Tod der Scham aufgebaut.“
Das Erbe des Rassismus und der Erfolg von Donald Trump
Wenn man in Alabama von Selma nach Montgomery reist, dreht sich alles um Geschichte – von der Sklaverei bis zu den Bürgerrechten, von zerfallenen Hütten der ehemaligen Farmpächter bis zu eindrucksvollen Gedenkstätten. Man spürt auch, dass es immer um Rassismus geht – vom historischen Marsch über die Edmund-Pettus-Brücke im März 1965 bis zum wiederholten Wahlsieg Donald Trumps im November 2024. Was hat sich verändert? Auf dieser 90 Kilometer langen Reise sieht man Zeichen weißer Vorherrschaft und schwarzer Verzweiflung, schwarzer Würde und weißer Angst. Man trifft Afroamerikaner, die von den jüngsten politischen Veränderungen entmutigt sind, und hört Geschichten von weißem Ressentiment, das die konservative Gegenreaktion schürt. Es liest sich wie eine fortlaufende Geschichte zweier Stämme, die beide verlieren.
Wenn man in Alabama von Selma nach Montgomery reist, dreht sich alles um Geschichte – von der Sklaverei bis zu den Bürgerrechten, von zerfallenen Hütten der ehemaligen Farmpächter bis zu eindrucksvollen Gedenkstätten. Man spürt auch, dass es immer um Rassismus geht – vom historischen Marsch über die Edmund-Pettus-Brücke im März 1965 bis zum wiederholten Wahlsieg Donald Trumps im November 2024. Was hat sich verändert? Auf dieser 90 Kilometer langen Reise sieht man Zeichen weißer Vorherrschaft und schwarzer Verzweiflung, schwarzer Würde und weißer Angst. Man trifft Afroamerikaner, die von den jüngsten politischen Veränderungen entmutigt sind, und hört Geschichten von weißem Ressentiment, das die konservative Gegenreaktion schürt. Es liest sich wie eine fortlaufende Geschichte zweier Stämme, die beide verlieren.
Vor der „Brown Chapel Church AME“ in Selma weist Pfarrer Alvin C. Bibbs die zwei Dutzend Teilnehmer seiner geführten Tour in die Regeln ihres kurzen, symbolischen Gangs von der Kirche zur Edmund-Pettus-Brücke ein. „Nehmt Wasser mit und lauft in der Sonne nur langsam.“ Doch wo die Mitglieder dieser Touristengruppe aus Chicago bequeme Turnschuhe tragen, hatten die Freiheitskämpfer von 1965 nur ihr normales Schuhwerk, um von der Kirche aus die Brücke zu überqueren und weiter nach Montgomery zu ziehen – auf ihrem viertägigen Marsch, der nicht nur die Geschichte des Südens veränderte.
Am “Blutigen Sonntag” des 7. März 1965 wurden die Freiheitskämpfer beim Versuch, die Brücke zu überqueren, brutal zusammengeschlagen. Doch zwei Wochen später konnten Martin Luther King und Tausende seiner Anhänger ihr Ziel unter dem Schutz der Nationalgarde erreichen, die Präsident Lyndon B. Johnson nach Alabama beordert hatte, nachdem die Fernsehbilder der ganzen Nation gezeigt hatten, wie rassistische Polizisten die Marschierer niederknüppelten und mit Tränengas traktierten, unterstützt von einem aus ganz Dallas County angereisten weißen Mob. Als Reaktion auf diesen Skandal verabschiedete der Kongress im August 1965 den „Voting Rights Act“, der den Grundstein für die Bürgerrechtsgesetzgebung in Amerika legte.
Nach dem symbolischen Gang seiner Reisegruppe über die Brücke 60 Jahre später erläutert uns Reverend Alvin Bibbs seine Sicht der jüngsten Geschichte und deren Zusammenhang mit Donald Trumps Wahlsieg. Geboren in einem der gewaltträchtigsten Wohnprojekte im Süden Chicagos, änderte sich Alvins Schicksal im Alter von sechs Jahren, als Martin Luther King bei einem Besuch seiner örtlichen Kirche „mit der Hand über meinen lockigen Afro-Kopf strich“ und dem Jungen seinen Segen gab. Von da an konzentrierte sich Alvin auf die Schule, gewann Sportlerstipendien, spielte Profi-Basketball in Spanien, wurde Pfarrer und leitet heute die „Justice Journey Alliance“, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Bürgerrechte einsetzt.
Alvin Bibbs hat eine jahrzehntelange konservative Kampagne erlebt, die darauf abzielte, „europäischen Amerikanern,die das Gefühl hatten, an wirtschaftlicher Macht, Einfluss und Status zu verlieren, Angst einzujagen”. Diese Dynamik der Angst habe in den ländlichen weißen Gemeinden im ganzen Land verfangen. „Und wenn man diese Sichtweise erst einmal übernommen hat“, versetzt sich der schwarze Pfarrer in die Lage weißer Wähler, „glaubt man leicht, dass man sein Land zurückerobern muss.“ Und jetzt sieht Alvin Bibbs, wie die Trump-Administration „das System der Bürgerrechte zerstört und die Geschichte unserer Bewegung diskreditiert“.
Man muss nicht schwarz sein, um diese Dynamik zu verstehen. Als Teilnehmerin der Reisegruppe findet Laura Jansen, die Geschäftsführerin einer anderen gemeinnützigen Organisation ist, noch schärfere Worte für das, was gerade in ihrem Land geschieht: „Viele weiße Amerikaner haben ihren Verstand verloren, als das Land zweimal für einen schwarzen Präsidenten gestimmt hat.“ Und mit diesem Schock der Jahre 2008 und 2012 erklärt sie den Erfolg von Donald Trump. „Im Grunde ist es Rassismus, nur in neuem Gewand.“
Am Fuße der Edmund Pettus Bridge treffen wir Charles, der als Reiseführer für die wenigen Touristengruppen arbeitet, die diesen historischen Ort besuchen. Man muss nur den Namen Donald Trump erwähnen, und schon platzt es aus Charles heraus, wie „trostlos und am Boden zerstört“ er sich angesichts des gegenwärtigen Rechtsrucks fühlt. Für ihn war der 21. März 1965 „der beste Tag in der Geschichte seines Landes“, und „der 5. November 2024 der schlimmste“. Auch er fürchtet nun, „dass die Errungenschaften der Bürgerrechtsära zunichte gemacht werden könnten“.
Charles ist aus Selma. Er war gut in der Schule und wollte Jura zu studieren, als seine Tochter geboren wurde und „Gott einen anderen Plan für mich hatte“. Stattdessen arbeitete er als Rohrschlosser und als Lagerarbeiter. In Alabama mit einem der landesweit niedrigsten Mindestlöhne wurde er Zeuge der Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, der “weißen Flucht”, der Auslagerung von Arbeitsplätzen und des Niedergangs der örtlichen Industrie. Aus seiner Sicht begann dieser 1978 mit der Schließung des nahegelegenen Armeestützpunkts und setzt sich bis heute mit der vor einer Woche angekündigten Schließung des “Selma AmeriCorps-Program” fort. „Wir wurden immer für das bestraft, was wir 1965 getan haben und wie wir seitdem gewählt haben“, glaubt er. Im November 2024 stimmten bei einer schwarzen Bevölkerungsrate von 70% knapp zwei Drittel der 36.000 Bürger von Dallas County für Kamala Harris.
Charles‘ Enttäuschung über das Leben reicht von den Touristen in Selma, „die die Geschichte nur blöde anstarren, aber nichts damit zu tun haben wollen“ über das viel zu niedrige Lehrergehalt seiner Frau bis zu den Kirchen mit ihren weißen Mitgliedern, „die damals mit der Bibel in der anderen Hand Steine und Tomaten auf uns geworfen haben“. Während der Gott, an den er glaubt, sagt man solle “die anderen Menschen lieben“. Dennoch steht Charles jeden Tag hinter seinem Klapptisch mit der Literatur zur Bürgerrechtsbewegung, um Touristen deren Geschichte kenntnisreich und mit Begeisterung zu erklären.
Direkt gegenüber von Charles’ kleinem Stand befindet sich das Büro des “Selma Times Journal“ Von hier aus hat Chefredakteur Brent Maze dieselben Entwicklungen beobachtet, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Das Blatt steht vor den gleichen wirtschaftlichen Herausforderungen wie alle vergleichbaren Lokalzeitungen im Land: Bevölkerungsschwund, zurückgehende Leserzahlen und sinkende Werbeeinnahmen. Vor sieben Jahren musste die Zeitung von seiner täglichen Erscheinungsweise auf zwei Ausgaben die Woche umstellen und ihren Personalbestand auf fünf Vollzeit-Kräfte reduzieren. Brent Maze kam aus einer aus Jackson, Mississippi, nach Selma. Sein Vater war als weißer Liberaler in der Bürgerrechtsbewegung aktiv.
Wie behandelt das “Selma Times Journal” die Rassenbeziehungen? „In der täglichen Berichterstattung“, sagt der Chefredakteur, „hast Du das Thema “race” immer im Hinterkopf. Doch schwarze Kriminalität komme nicht mehr automatisch auf die Titelseite, erklärt Brent eine subtile Veränderung. „Es sei denn, es handelt sich um Mord.“ Brent Maze zählt die „Premieren“ in Selmas jüngerer Geschichte auf: den ersten schwarzen Bürgermeister Ende der 2000er Jahre, den Besuch von Präsident Obama zum 50. Jahrestag des „Bloody Sunday“, als sich die Menschenschlange über zwei Häuserblocks erstreckte; und vor kurzem das erste komplett schwarze “school board”, auch wenn weiße Schüler immer noch auf zwei Privatschulen ausweichen.
Doch er hat auch Rückschritte erlebt, als etwa im Jahr 2008 traditionell konservative Demokraten zu den Republikanern überliefen; „als die Präsidentschaft Obamas bei weißen Bürgern die Angst schürte, ihre Identität zu verlieren“; als das singuläre Thema der Abtreibung der Demokratischen Partei in Alabama schwer zusetzte und weißen Pastoren predigten, man könne nicht gleichzeitig Christ und Demokrat sein. „Der Aufstieg von Donald Trump“, erklärt der Chefredakteur, „fiel mit diesen Gefühlen in der weißen Bevölkerung zusammen.“
Beim Blick aus seinem Bürofenster kann Brent Maze bereits die aktuellen Folgen dieser langfristigen politischen Veränderungen erkennen. Auf der Baustelle des „Selma Interpretive Center“ wird nicht mehr gearbeitet seit Elon Musk den Etat des National Parks Service kürzte, der diesen neueste Erweiterung Civil Rights Stätten für Touristen betreiben sollte. Und letzte Woche musste der Bürgermeister Kürzungen der Bundesmittel in Höhe von 55 Millionen Dollar ankündigen, was die Pläne der Stadt zur Sanierung ihrer Infrastruktur zunichte machen wird. Der Wahlslogan des schwarzen Bürgermeisters von Selma „Gemeinsam wieder aufbauen“ dürfte bald hohl klingen.
Auf unserer knapp einstündigen Fahrt von Selma nach Montgomery haben wir Zeit, das Gehörte mit dem zu vergleichen, was wir vor unserer Ankunft im Süden gelesen haben. Zum Beispiel Franz Fanons berühmtes Zitat „Der weiße Mann als Sklave seiner Überlegenheit“ aus seinem 1952 erschienenen Buch „Schwarze Haut, weiße Masken“. Darin schreibt der revolutionäre Kolonialismuskritiker und Psychiater über die Angst der Weißen, aufgrund der Forderungen der schwarzen Bevölkerung nach Gleichheit ihre privilegierte Stellung zu verlieren.
Oder Robert Kagans neues Buch „Rebellion“, in dem der Autor die antiliberale Strömung in der amerikanischen Geschichte mit den Themen “race and religion” in Zusammenhang bringt, die als ständiger Subtext Feindseligkeit und Angst in der weißen Bevölkerung nähren. Mit der Wahl Barack Obamas, schreibt Kagan, sei „ein offener Rassismus wiederaufgetaucht, wie man ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.“ „Als Donald Trump 2016 (für das Präsidentenamt, R.P.) kandidierte, “schreibt der konservative Historiker, “war seine Identität als weißer männlicher Suprematist bereits fest etabliert.“
Wie in der Stadt Selma empfängt einen das Zentrum von Montgomery mit leeren Straßen, aber vielen Gedenkstätten. Die Memorials glänzen wie moderne Hülllen für eine dynamische Vergangenheit, als wäre der erbitterte Kampf um die Bürgerrechte in die sicheren Räume beeindruckender Museen verlagert worden. Die Stadt selbst mit ihren 200.000 Einwohnern wirkt trotz einiger erfolgreicher Stadterneuerungsprojekte immer noch wie ein verlassener, träger und sturer Ort im amerikanischen Süden, mit einigen protzigen, neoklassisch verkleideten Bürotürmen, denen es an zeitgenössischer Präsenz und Dynamik mangelt.
Und auch die jüngsten Veränderungen, die Dwayne Fatherree bemerkt, sind nicht zum Besseren. Der erfahrene Journalist, der für das renommierte „Southern Poverty Law Center“ (SPLC) recherchiert und schreibt, berichtete kürzlich über die lokalen Auswirkungen der Dekrete von Donald Trump und Elon Musk. Da das SPLC und die meisten historischen Stätten in Montgomery privat finanziert werden, sind sie von den Kürzungen der Diversity-Programme kaum betroffen. Doch manche NGOs und Monitoring-Gruppen werden es spüren, wenn die Regierung staatliche Wohnungsbau- und Mietzuschüsse kürzt. Und die zahlreichen rechts-radikalen „Hassgruppen“, die das SPLC seit Jahrzehnten beobachtet, befürchtet Dwayne, „werden sich durch diese neuen Maßnahmen bestärkt fühlen.“ In der Vergangenheit hätten konservative Politiker noch eine gewisse Philosophie und Disziplin gehabt, fährt der weiße Journalist fort. „Jetzt sind sie nur noch darauf aus, alles zu zerstören, was nicht zu ihnen gehört.“
Und wie reagieren die verschiedenen Gemeinschaften auf die Angriffe der neuen Regierung? Während sich die weiße Community ermutigt fühle, ihren passiven Rassismus auszuüben, vermutet Dwayne, „denken die Leute in der schwarzen Community vielleicht, dass sie schon alles gesehen haben und es nicht mehr viel schlimmer kommen kann.“
Zurück in den Straßen von Montgomery halten Touristenbusse kurz an der „Dexter Avenue Memorial Church“, wo deren ehemaliger Pastor Martin Luther King und die Freedom Riders den Busboykott von Montgomery und den Marsch von Selma planten. Anschließend entleeren sie ihre Ladung überwiegend schwarzer Besucher im interaktiven „Legacy Museum“ und dem visuell eindrucksvollen „National Memorial for Peace and Justice“. Wir werden dieser Route folgen.
Es ist der sonntägliche Gottesdienst in der „Dexter Avenue Memorial Baptist Church“. Mit den Kadenzen von Blues und Gospel unterlegt der Organist die Gebetsrufe im “Call and Response”. Der kleine, in weiße Spitze gekleidete Frauenchor singt in hellen Tönen und Pastor Allen Sims predigt mit Emphase – aber alles vor halb leeren Kirchenbänken. Die Geschichte dieser engagierten Kirche ist keine Garantie mehr für zeitgenössischen Glauben. Und dafür gibt es politische Gründe, wie uns Reverend Dr. Allen Sims nach dem Gottesdienst erläutern wird.
Er erklärt uns den Trend von den kleinen Kirchen wie der seinen zu den Megakirchen der meist weißen Evangelikalen, und dass die kleinen Kirchen mit den Aids- und Covid-Epidemien sehr zu kämpfen hatten. Und im Laufe der Jahre, so der Pfarrer, seien die Evangelikalen mit der Republikanischen Partei nach rechts gerückt, “weil sie ein Stück vom Kuchen abhaben wollten”. Er spricht von einer „tiefen Enttäuschung” über weiße Pastoren, die er früher respektiert habe, die aber “in diesen schwierigen Zeiten schweigen, wie auch die Universitäten.“
Doch Pastor Sims tadelt nicht nur seine Kollegen in den weißen Megakirchen. Er ermahnt auch die Afroamerikaner, „die dachten Barack Obama sei unser Retter“. Die anschließende Ernüchterung und das Misstrauen, so sieht er das heute, hätten dazu geführt, “dass ein ganze Reihe afroamerikanischer Männer eben nicht für Kamala Harris gestimmt haben“. Heute sieht Rev. Dr. Allen Sims - in der langen Reihe der „politischen“ Pastoren nach Martin Luther King - das Land und die Kirchen „am Scheideweg“. Gibt es Hoffnung oder keine Hoffnung? Er scheint sich da nicht sicher zu sein. Angesichts des großen Engagements der Anwesenden beim Sonntagsgottesdienst, aber auch der leeren Reihen in seiner Kirche versteht man seine Unsicherheit.
Weiter geht es zum „Legacy Museum“ auf dem Gelände eines ehemaligen Sklavenmarktes. Seine eindrücklichen Installationen dokumentieren die Geschichte von “race” als Amerikas Erbsünde mit fast strafrechtlicher Härte: von der Sklaverei über die Zeiten von “Reconstruction” und “Jim Crow” bis hin zur fortdauernden Inhaftierung schwarzer Männer. Was natürlich fehlt, ist die jüngste Wendung in dieser Geschichte: die aktuelle Reinkarnation des Rassismus, definiert als Nullsummenspiel zwischen einem gefühlten Statusverlust in der weißen Bevölkerung und den imaginierten Gewinnen für schwarze oder braune US-Bürger.
Deshalb fragen wir einige Besucher, wie sie die dargestellte Geschichte der Schwarzen mit der heutigen politischen Landschaft verknüpfen. Angesichts der brutalen Bilder aus der Vergangenheit des Südens, die er gerade zwei Stunden lang durchwandert hat, ist Eddie, ein Geschäftsmann aus Atlanta, “wütend auf meine schwarzen Brüder, die Donald Trump nur wegen der Steuererleichterungen gewählt haben“. Und nachdem seine erwachsene Tochter die dramatischen Darstellungen von Familien gesehen hat - durch Sklaverei auseinandergerissen, durch Lynchmorde traumatisiert und durch das heutige Strafrecht weiter benachteiligt - glaubt sie, „dass wir in der schwarzen Gemeinschaft uns noch mehr auf unsere Familien konzentrieren müssen“. Gemeinsam steigen wir in den Shuttlebus, der uns zum „National Memorial for Peace and Justice“ bringt.
Diese 2018 eröffnete, jüngste Stätte in der Reihe der großzügig gestalteten Legacy Sites ist ein offener Pavillon, der mehr als 4.000 rassistisch motivierte Lynchmorde zwischen 1877 und 1950 visualisiert. Hier, zwischen teils hängenden, teils stehenden Zylindern aus rostfarbenem Cortenstahl, treffen wir Anthony und Wendell, zwei Besucher aus North Carolina. Als sie die Platte mit den eingravierten Zahlen der lynchings in Nash County suchen und finden, kann Anthony nicht glauben, was er da liest: an einem einzigen Tag wurden in seinem Heimatbezirk 20 schwarze Bewohner gelyncht, vor Tausenden weißen Zuschauern, wie der Eintrag auf der rostigen Oberfläche besagt. „Das geschieht, wenn man bestimmte Gruppen für andersartig erklärt, so wie wir es heute mit Migranten tun“, sagt Anthony, noch immer atemlos angesichts der schockierenden Entdeckung über die grausame Geschichte seines Heimatbezirks.
Vor einer weiteren schockierenden Skulptur im Garten der Gedenkstätte mit Blick auf die Innenstadt von Montgomery fragen wir Charity, eine Studentin am Georgia Institute of Technology, wie sie das hier symbolisierte Erbe der Lynchmorde, mit dem verbindet, was Amerika heute widerfährt.
Charity ist mit ihrer Familie gekommen, doch inmitten der Besucherschar aus schwarzen Schulklassen und weißen Touristen aus dem Norden vermisst sie die weißen Bürger aus Georgia oder Alabama, „diejenigen, die immer noch nicht verstanden haben, was systemischer Rassismus ist. Denn wir haben zwar die gleichen Rechte, aber stehen immer noch vor vielen Hindernissen.“ Und jetzt, mit Donald Trump, sagt sie mit einer Bitterkeit, die nicht zu ihrem Alter passt, „werden die Förder- und Diversitätsprogramme, die uns helfen sollten, diese Hindernisse zu überwinden, einfach abgeschafft.“
Marjorie Taylor Greene und die Lizenz zu hassen
Wer die letzten Kurven von den malerischen Blue Ridge Mountains in den Nordwesten Georgias hinunterfährt, würde nicht vermuten, dass die Menschen, die diese sanfte Landschaft bewohnen, dreimal hintereinander die rabiateste Kongressabgeordnete im US-Repräsentantenhaus gewählt haben. Wenn man dann nach Dalton hineinfährt, das sich stolz „Teppichhauptstadt der Welt“ nennt, glaubt man kaum, dass diese respektable Stadt so viel Groll und Wut ihrer Bürger in sich birgt, dass sie eine verrückte Verschwörungstheoretikerin nach Washington D.C. schickt, die wiederholt zu Gewalt gegen Demokraten und andere Gegner der MAGA-Bewegung aufruft. Diese Geschichte handelt davon, wie die durchgeknallte Kandidatin Marjorie Taylor Greene im 14. Kongresswahlbezirk in Georgia zwischen der Grenze zu Tennessee und den Vororten Atlantas als Siegerin hervorgehen konnte – und wie sie von den Bürgern in Dalton wahrgenommen wird.
Wer die letzten Kurven von den malerischen Blue Ridge Mountains in den Nordwesten Georgias hinunterfährt, würde nicht vermuten, dass die Menschen, die diese sanfte Landschaft bewohnen, dreimal hintereinander die rabiateste Kongressabgeordnete im US-Repräsentantenhaus gewählt haben. Wenn man dann nach Dalton hineinfährt, das sich stolz „Teppichhauptstadt der Welt“ nennt, glaubt man kaum, dass diese respektable Stadt so viel Groll und Wut ihrer Bürger in sich birgt, dass sie eine verrückte Verschwörungstheoretikerin nach Washington D.C. schickt, die wiederholt zu Gewalt gegen Demokraten und andere Gegner der MAGA-Bewegung aufruft. Diese Geschichte handelt davon, wie die durchgeknallte Kandidatin Marjorie Taylor Greene im 14. Kongresswahlbezirk in Georgia zwischen der Grenze zu Tennessee und den Vororten Atlantas als Siegerin hervorgehen konnte – und wie sie von den Bürgern in Dalton wahrgenommen wird.
Mit Marjorie Taylor Greene, kurz MTG, wird der traditionell republikanische Distrikt nun von einer 50-jährigen Mutter dreier Kinder vertreten, deren frühere Lebensleistung darin bestand, von ihrem Vater eine Baufirma geerbt und das CrossFit-Fitnessstudio im nahegelegenen Alpharetta geführt zu haben, ehe ihre politische Karriere nach dem plötzlichen Eintauchen in die rechtsextreme Blogosphäre begann. Bald schon schloss sie sich der QAnon-Verschwörungstheorie an, wonach die Welt von einem Netzwerk satanischer Pädophiler kontrolliert wird, finanziert von dem jüdischen Philantrophen George Soros.
MTG präsentierte sich in den sozialen Medien als “pro gun”, “pro life”, pro-weiße Männer, ultrachristlich, antimuslimisch und pro-Israel aber durchaus antisemitisch. Ihre politische Karriere begann mit der Unterstützung der Trump-nahen Republikaner im Repräsentantenhaus, als sie alle gemäßigten Rivalen in den Vorwahlen aus dem Rennen warf. Seitdem gewann sie 2020, 2022 und 2024 den 14. Distrik von Georgia.
„Die republikanische Basis war auf der Suche nach einer Marjorie Taylor Greene – einer Frau aus der Vorstadt, die nicht vor Trump zurückschreckte und eine überzeugte Anhängerin der MAGA-Bewegung war“, erklärte das Magazin „The Atlantic“ 2022 ihren politischen Erfolg. Im letzten Wahlkampf erkärte MTG: „Die Demokraten wollen die Republikaner erledigen, und sie haben bereits mit dem Morden begonnen.“ Heute leitet MTG in Washington, D.C., den Unterausschuss des Repräsentantenhauses, der Elon Musks DOGE-Einheit für Regierungseffizienz beaufsichtigen soll. Sie ist so sehr MAGA, dass sie ihren geliebten Präsidenten von rechts kritisiert, wenn er auch nur einen Zentimeter von seinen absurden Versprechungen abweicht. So viel zu ihrer politischen Karriere.
Doch wer waren die 243.446 Menschen (64,37 % des Wählervolks) in diesem Kongresswahlbezirk und die 25.767 Bürger (66 %) von Whitfield County, einschließlich der Stadt Dalton, die im vergangenen November für eine so extremistische Kandidatin gestimmt haben? Sharon, die im Bildungssektor arbeitet und ihren richtigen Namen lieber nicht nennen möchte, hat dazu einige Vermutungen. „In diesem zutiefst konservativen Teil Georgias“, beginnt sie, „sind es Menschen, denen sich die Welt zu schnell dreht, die keinen Fortschritt und keine weitere Zuwanderung von Hispanics wollen, Leute, die ihre eigene Geschichte zerstört sehen, wenn Statuen der Konföderierten aus der Stadt auf die historischen Schlachtfelder gebracht werden.“
In den sozialen Medien beobachtet Sharon, dass die Leute jemanden, der den Status quo durchbricht, „ziemlich unterhaltsam” finden – “der Schockeffekt nährt ihre Wut“. „Es ist, als würde MTG ihnen die Erlaubnis geben, offen hasserfüllt zu sein.“ Sharon erinnert sich an die Zeit, als die Bürger von Dalton die Einwanderer noch willkommen hießen, die in den 90er Jahren in Mexiko angeworben wurden, um in den Teppichfabriken der Region zu arbeiten. Jetzt verfolgt sie auf Facebook, dass Menschen aus ihrer Community „einfach unglaublich rassistisch sind“.
Was konservative Autoren schon lange befürchten und das US Census Bureau für das Jahr 2044 voraussagt – nämlich dass der Anteil der nicht-hispanischen weißen Bevölkerung in den USA unter 50 % sinken wird – ist in Dalton und Whitfield County längst eingetreten. Heute sind 54 % der 35.000 Einwohner der Stadt Hispanics.
Als die Teppichproduzenten in den frühen 90er Jahren erkannten, für welch geringe Löhne Saisonarbeiter aus Mittelamerika in der lokalen Landwirtschaft arbeiteten, begannen sie, Latinos auch für ihre Industrie anzuwerben. Während heute 80 % der weltweiten Bodenbeläge in den über 300 Teppichfabriken der Region hergestellt werden, ist dieser wirtschaftliche Erfolg hauptsächlich auf den Import billiger Arbeitskräfte zurückzuführen. Er hat auch eine Reihe weißer Milliardäre hervorgebracht.
An den Banken und in den Schaufenstern von Dalton sieht man zweisprachige Schilder, und sobald man das Stadtzentrum in Richtung Osten verlässt, tragen die Autowerkstätten, Reparaturshops und Restaurants zunehmend hispanische Namen. Kaum jemand in Dalton bestreitet, dass die Latino-Familien von Arbeitern, Kleinunternehmern, stolzen Hausbesitzern und Anwälten gut integriert sind. Es gibt keine Anzeichen für offene Konflikte, doch für viele Bürger scheint dieser produktive Zustrom dann doch zu viel gewesen zu sein.
Was können die lokalen Mitglieder der Demokraten von Whitfield County tun, um diesen Kongresssitz für ihre Partei zurückzuerobern? Um diese Frage zu beantworten, haben sich Mary, Sheryl, Debbie und Dan im modernen Arts Guild Center in Dalton neben der geräumigen und gut ausgestatteten öffentlichen Bibliothek eingefunden. Regelmäßig protestieren sie mit ihren Anti-Trump-Plakaten vor der MTG-Geschäftsstelle gegen den Hass und die Gewalt ihrer politischen Gegnerin.
Dan, der als Manager eines Recyclingunternehmens arbeitet, kann gut erklären, was der Republikanischen Partei im Laufe der Jahre auf nationaler Ebene widerfahren ist. Er erzählt, wie seit Ronald Reagans Zeiten die „Architekten der großen Südstaatenstrategie das religiöse Gefühl eingefangen haben”; dass „Gott zum Wahlautomaten geworden und nicht mehr der liebende Gott ist“; dass das Thema Abtreibung eine große Rolle spielte; und dass ein schwarzer Präsident die Lage für die Demokraten verschlechtert und danach leider viele Menschen zum Seitenwechsel bewegt habe. “So wurden aus rassistischen Demokraten rassistische Republikaner.“ Diese hätten das Gefühl, dass die Regierung sie übergangen hat und dass die Trickle-down-Ökonomie nicht funktioniert, da die Immobilienpreise explodiert sind. In Marjory Taylor Green, sagt Dan, „haben sie eine Führungspersönlichkeit gefunden, die genau die Menschen hasst, die auch sie hassen.“
Aber Mary und Sheryl verstehen immer noch nicht wirklich, was mit ihrer Gemeinde geschehen ist. Die Wahl von MTG, sagt Mary, „passt nicht zu unserer Lebensweise und den Menschen, die wir auf gesellschaftlichen Veranstaltungen treffen.“ Aber die konservativen Botschaften über die Demokraten seien eben seit Jahren durchweg schlecht gewesen, wirft Dan ein, und die Leute glaubten einfach diese Erzählung. „Wir Demokraten“, sagt eine von ihnen, „sind Teil der “des Anderen“ geworden.
Die regelmäßige Umfrage der „Atlanta Journal Constitution“ zeigt in der Woche, in der wir uns treffen, dass nur 35 % der registrierten Wähler in Georgia eine positive Meinung von der Demokratischen Partei haben, nachdem Trump den Bundesstaat bei seiner Rückkehr an die Macht mit großer Mehrheit gewonnen hat. Sogar ein Drittel der liberalen Wähler hat eine negative Wahrnehmung der Partei. „Eine Rebellion genau derjenigen, von denen erwartet wurde, dass sie ihre Vision vertreten“, kommentiert die Zeitung das schlechteste Umfrageergebnis der Demokraten aller Zeiten.
Was also können demokratische Aktivisten auf lokaler Ebene gegen den nationalen Trend und die politische Dynamik in ihrem Bundesstaat tun? Sie nennen viele Punkte: Konzentration auf Kommunalwahlen; Rekrutierung besserer Kandidaten für Verwaltungs- und Schulbehörden; Spenden für die Wiederwahl des demokratischen Senators im Jahr 2026 sammeln; sich für Wählerschutz einsetzen und den Wahlprozess vor republikanischen Manipulationen schützen; die Menschen ansprechen, die nicht gewählt haben; und schließlich, die Latino-Bevölkerung erreichen.
Angesichts meiner eigenen, meist vergeblichen Versuchen, mit Hispanics in Dalton ins Gespräch zu kommen, wird Letzteres ein schwieriges Unterfangen werden. Die drei hispanischen Jugendlichen im Stadtzentrum sind erst vor ein paar Monaten aus Kalifornien angekommen und haben noch nie von Marjorie Taylor Greene gehört. Carla, die hinter einer hispanischen Anwaltskanzlei Würstchen brät, um für deren Einwanderer-Service zu werben, will nicht wirklich sagen, ob sie weiß, worum es MTG geht, nachdem sie vor 17 Jahren aus El Salvador hierhergekommen ist.
Endlich finden wir auf dem örtlichen Baseballplatz in Rollins Park das vielfältige und integrierte Umfeld vor, von dem unsere demokratischen Aktivisten gesprochen hatten. Weiße, schwarze und Latino-Kinder spielen vor den Augen ihrer Eltern Baseball in einer friedlichen und entspannten Atmosphäre. Die Szene wirkt wie eine Werbung für die Traumlandschaft eines multikulturellen Amerikas. Nur dass niemand von der hispanischen Seite über Trump, MTG oder Politik reden will. Der Preis für erfolgreiche Integration scheint die vollständige Abwendung von Politik zu sein. Solange das so bleibt, haben die Demokraten in Dalton kaum eine Chance.
Später am Abend treffen wir in der „Dalton Brewery“ einen alten weißen Mann, der bereit ist, über Politik und Marjorie Taylor Greene zu reden. Er ist Rentner, muss aber trotzdem drei Tage die Woche arbeiten, um über die Runden zu kommen. Bei dem kleinen Glas Bier für 6,45 Dollar, das vor ihm steht, weiß man warum. Und MTG? „Sie ist so verrückt wie Fledermausscheiße“, sagt er, „aber ich habe sie gewählt.“ Und wenn man ihn nach dem Grund fragt, markiert seine Antwort wohl die erfolgreichste Botschaft aus Donald Trumps jahrzehntelanger Dominanz der Medienwelt: „Weil die Demokraten all das Geld einfach weggegeben haben”. An wen kann sich jeder Trumpwähler denken.
Amerikas Veteranen und der Niedergang des Patriotismus
Als ich während des ersten Golfkriegs 1991 durch Amerika fuhr, war ein immenser Stolz auf die Soldaten und Veteranen des Landes zu spüren. Die Menschen feierten die 43 Tage der „Operation Desert Storm“ in Kuwait als Wiedergutmachung für die Niederlage in Vietnam. In jedem Vorgarten prangten Schilder mit der Aufschrift „Unterstützt unsere Truppen“, und in jeder Stadt fanden Siegesparaden statt. Doch 2015 konnte Donald Trump Kriegshelden und Kriegstote als „Verlierer“ und „Trottel“ bezeichnen und trotzdem ins Weiße Haus einziehen, da fast zwei Drittel der amerikanischen Veteranen seitdem konsequent für ihn stimmten. Als “Dankeschön” treffen die jüngsten Kürzungen von Elon Musks Stoßtruppe für Regierungseffizienz (DOGE) Veteranen überproportional, da sie ein Drittel der Bundesbediensteten ausmachen. Und gerade hat Donald Trump angekündigt, den traditionellen Feiertag des „Veterans Day“ in „Tag des Sieges im Ersten Weltkrieg“ umzubenennen? Wie konnte ein solcher „winner-takes-it-all“- und engstirniger Nationalismus den tiefempfundenen Patriotismus vergangener Zeiten ersetzen?
Als ich während des ersten Golfkriegs 1991 durch Amerika fuhr, war ein immenser Stolz auf die Soldaten und Veteranen des Landes zu spüren. Die Menschen feierten die 43 Tage der „Operation Desert Storm“ in Kuwait als Wiedergutmachung für die Niederlage in Vietnam. In jedem Vorgarten prangten Schilder mit der Aufschrift „Unterstützt unsere Truppen“, und in jeder Stadt fanden Siegesparaden statt. Doch 2015 konnte Donald Trump Kriegshelden und Kriegstote als „Verlierer“ und „Trottel“ bezeichnen und trotzdem ins Weiße Haus einziehen, da fast zwei Drittel der amerikanischen Veteranen seitdem konsequent für ihn stimmten. Als “Dankeschön” treffen die jüngsten Kürzungen von Elon Musks Stoßtruppe für Regierungseffizienz (DOGE) Veteranen überproportional, da sie ein Drittel der Bundesbediensteten ausmachen. Und gerade hat Donald Trump angekündigt, den traditionellen Feiertag des „Veterans Day“ in „Tag des Sieges im Ersten Weltkrieg“ umzubenennen? Wie konnte ein solcher „winner-takes-it-all“- und engstirniger Nationalismus den tiefempfundenen Patriotismus vergangener Zeiten ersetzen?
Ein geigneter Ort, um mehr über diese Veränderungen und Widersprüche zu erfahren, ist Tuskegee, Alabama, Heimat der „Tuskegee Airman National Historic Site“. Hier, in den alten Hangars eines Flugfeldes, wird die Geschichte der ersten Afroamerikaner erzählt, die im Zweiten Weltkrieg zu Piloten des Army Corps ausgebildet wurden. Hier werden die Erfahrungen der schwarzen Piloten realistisch und drastisch dargestellt, der Skandal ihrer rassistischen Diskriminierung und der Stolz auf ihre Leistungen; außerdem die Rückkehr vom siegreichen Kampf im Ausland in ihre alte Rolle als Bürger zweiter Klasse daheim.
Hier treffen wir Eric Walker, seine Schwester Sharon und ihren Neffen Blair, die sich die vielfältigen Darstellungen von Rassismus und Patriotismus in einem Museum ansehen, das leider nur wenige Besucher hat. Sie bezeichnen sich selbst als „stolze Militärfamilie“. Ihr Onkel Robert war ein Tuskegee Airman, für den, wie sie erzählen, die erlittene Diskriminierung ebenso traumatisch war wie die Flüge über feindlichem Gebiet. Eric selbst diente 15 Jahre lang in der Armee in Asien, Sharon war in der Reserve. Sie haben ihren Neffen mitgebracht, „um etwas über unsere Geschichte zu lernen“.
Wo aber ist dieser Patriotismus geblieben? „Die Menschen haben kein Gedächtnis, kein Interesse mehr an Geschichte oder den Dingen außerhalb ihres eigenen Lebens“, sagt Eric, „und eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.“ Das Bild, das er verwendet, um die aktuelle Mischung aus Gedächtnisverlust und Unschuld zu beschreiben, ist das von Rip van Winkle, dem Helden eines beliebten Kinderbuchs, der nach 20 Jahren Tiefschlaf verwirrt aufwacht, während die Vereinigten Staaten sich von einer britischen Kolonie in ein unabhängiges Land verwandelt haben. „Die Leute sind vewirrt und von all dem anderen Zeug überwältigt.“
The Gift Shop at the Central alabama Veteran Affairs Medical Center in Tuskegee, Alabama
Tuskegee beherbergt auch das „Central Alabama Veteran Affairs Medical Centre“ mit zahlreichen Einrichtungen außerhalb der Stadt. Auf meine Frage antwortet einer der medizinischen Mitarbeiter: „Die Kriege in Afghanistan und im Irak haben die Menschen gegen den Patriotismus aufgebracht. Sie fühlen sich vom militärisch-industriellen Komplex verarscht.“ Und nun beobachtet er, wie viele seiner Patienten in der Röntgenabteilung Angst haben, dass Elon Musk und sein Team die Leistungen und Sonderprogramme kürzen könnten. Menschen wie James mit seinen 64 Jahren, den wir in der Kantine treffen. Er hat bei den California Cannoneers gedient und kämpft nun um ein neues Hörgerät. Vielleicht bekommt er es ja noch, und er ist sich sicher, dass seine zukünftige Rente von 35.000 Dollar nicht angetastet wird. Aber das Programm, das ihn von den Drogen abbrachte und ihn vor der Obdachlosigkeit bewahrte, ist eine andere Sache. „Das wird es für andere vielleicht nicht mehr geben, wenn ich weg bin“, befürchtet er.
Nach der Volkszählung von 2023 leben in Amerika fast 16 Millionen Veteranen, von denen 66.000 noch im Zweiten Weltkrieg kämpften. Das entspricht etwa 6 % der Gesamtbevölkerung gegenüber 18 % im Jahr 1980. 2024 verfügte das Department of Veteran Affairs (VA) über ein Budget von 129 Milliarden Dollar und sorgte mit rund 400.000 Mitarbeitern für die lebenslange Pflege und Versorgung von neun Millionen Veteranen. Doch das sogenannte „Projekt 2025“, die Blaupause für viele politische Maßnahmen der Trump-Administration, sieht Kürzungen bei den Leistungen für behinderte Veteranen und die Ersetzung der VA-Krankenhäuser durch privatisierte Ambulanzen vor. Ein internes Memo vom März 2025 spricht von 80.000 Stellenstreichungen beim VA ab Juni.
Bislang ist nicht bekannt, wie viele VA-Mitarbeiter bereits ihre Kündigungen erhalten haben; einige wurden gefeuert und kurz darauf wieder eingestellt. Sharon bei den Tuskegee Airmen erklärt, dass Finanzmittel des Museums gekürzt und erst nach heftigen Protesten der schwarzen Community wieder freigegeben wurde. Landesweit protestieren viele Veteranengruppen gegen das „Chaos“, das diese Anordnungen und verwirrenden Maßnahmen verursacht haben.
Aber warum greift man die Regierungsbürokratie dort an, wo sie den Schwächsten und Behinderten dient? Ein Artikel im „The Atlantic“ vom September 2020 listet eine ganze Litanei von Donald Trumps verächtlichen Äußerungen über Helden, Kriegsopfer und den Militärdienst auf. Die hier zitierten Quellen zeichnen das Bild einer Person, die einen Militärfriedhof meidet, weil „er voller Verlierer ist“; die Konzepte wie Patriotismus, Dienst und Opferbereitschaft nicht versteht, weil dies „nicht-transaktionale Lebensentscheidungen“ sind; das Bild eines Präsidenten, der “eine tiefsitzende Angst davor hat, zu sterben oder entstellt zu werden, und diese Sorge manifestiert sich in Abscheu vor denen, die gelitten haben“.
In Montgomery, unweit von Tuskegee, treffe ich den Journalisten Dwayne Fatherree, der die Psychopathologie des Präsidenten politisch fasst. „Mit Donald Trump erleben wir eine Verschiebung dessen, was wir heute als Erfolg und als Patriotismus definieren.“ „Erfolg ist was einem direkt nutzt und die weißen amerikanischen Patrioten von heute sind eine Gruppe von Leuten, für die Weltpolitik kein Thema mehr ist. Für sie ist da draußen “Der Andere.“
Doch wie konnte dies in einer Republikanischen Partei geschehen, die historisch lange Zeit auf der Seite der Veteranen und der Streitkräfte stand? Alles begann mit dem Fall der Berliner Mauer 1989, als die Republikanische Partei ihre ideologische Orientierung verlor. Nachdem der anfänglichen Versuch des, „Amerika First” Mitte der 90er Jahre mit einer Niederlage gegen Präsident Bill Clinton endete, nachdem die Bush-Jahre „ewige Kriege“ und eine Finanzkrise hervorbrachten und Barack Obama 2008 als erstem schwarzen Präsidenten den Weg ebneten, fand die Republikanische Partei endlich einen neuen Feind im Innern des Landes. Zu diesem Zeitpunkt gab es wieder genug Ressentiments und Rassismus, um die neue Propaganda zu befeuern.
Mithilfe einflussreicher rechter Medien tauften die Verfechter des weißen Nationalismus die liberale und „woke“ demokratische Linke als die neuen „Kommunisten“ im eigenen Land. Und es funktionierte. Bis November 2016 hatten Ideologen wie Steve Bannon, dank Fox TV, den Boden für einen egotistischen Entertainer bereitet, der das Weiße Haus usurpierte, indem er einen christlichen Nationalismus ohne jegliche Moral präsentierte, in dem sich jeder selbst der nächste ist. Und es spricht für die Überzeugungskraft von Trumps Performanz, dass dieses lange reifende Projekt sogar bei Menschen Anklang findet, die darunter leiden.
Denn wenn man durch Amerika reist und hier und da mit Veteranen, bleiben viele ihrem Präsidenten treu, egal, was seine Politik mit ihnen macht; Männer wie Bubba, den wir am Posten 3016 der „Veteran of Foreign War“ in Selma, Alabama, treffen. Bubba hat in keinem Krieg gekämpft. Er diente von 1970 bis 1976 nur in der Nationalgarde, „um dem Vietnamkrieg zu entgehen“. Aber er kommt gerne hierher, wegen der Kameradschaft und um am späten Nachmittag ein Bier zu trinken.
Hat er Donald Trump gewählt? „Ja, natürlich, und ich bereue es nicht.“ Und was ist mit der offenen Verachtung des Präsidenten für Veteranen? „Ich hatte ja keine Wahl“, sagt er, denn Kamala Harris hätte die Grenzen offen gehalten. Er erzählt mir, dass viele Weiße Selma verlassen haben, „weil sie denken, die Schwarzen hätten die Macht übernommen“. Er hat Donald Trump gewählt, „damit die Steuergelder nicht weiter an alle Sozialhilfeempfänger gehen, nur nicht an mich“. Für Bubba scheint das wichtiger zu sein als die Wertschätzung der „Veterans of Foreign Wars“. Und viele in den vielleicht 5.000 VFW-Posten des Landes dürften im Augenblick ähnlich denken wie Bubba.
Nachdem ich das beeindruckende Fliegermuseum in Tuskegee verlassen hatte, schickte mir Eric Walker aus der “stolzen schwarzen Familie mit einer langen Geschichte im Kampf für die Freiheit“ eine E-Mail, in der er seine vorherigen Kommentare noch ergänzt: „Ich schäme mich für mein Land mit Trump und seiner Idiotenbande. Aber was mich zutiefst trifft, ist die schiere Zahl der Menschen, die für ihn gestimmt haben.“
Man fragt sich, was mit Amerika geschehen muss, damit diese Art Stolz wieder gewürdigt wird.